LESEN AM COMPUTER – MEHRWERT ODER MEHR VERWIRRUNG? UNTERSUCHUNGEN ZUR ›KONKURRENZ‹ ZWISCHEN BUCH UND HYPERTEXT
Wir leben in neuen Kommunikationsverhältnissen, die mit dem Leitmedium der Neuzeit, dem Buch, gebrochen haben. Computer und elektronische Medien befördern das Ende einer Welt, die Marshall McLuhan Gutenberg-Galaxis genannt hat.[1]
Abstract
The past decade has seen the rise of quite a few new technologies. The computer and the internet have undoubtedly reached the status of mass media by now and discussions have been led about whether this phenomenon will finally force the exodus of ›the book‹ and of ›reading‹ – discussions that are well known from earlier times as in regard to the assumed competition between other electronic technologies, e.g. television, and the print media. This essay aims to take a closer look at these theories and tries to distinguish two different levels of the discussion that tend to be mixed up easily, as on one hand arguments are presented that relate to the medium itself and on the other hand arguments that relate to its products, such as the hypertext. Further to this, the essay aims to oppose the mentioned theories and assumptions with factual reality and examine their validity. It builds up on the results of a representative study investigating the attitude towards media in Germany in 2000 and it concludes that – at the time being – no extrusion of ›the book‹ or ›reading‹ in favour of the use of new technologies can be observed. Moreover, this essay aims to show that the assumed ›added value‹ of the hypertext (compared to linear presentation of printed text) should be studied more carefully. Hypertext does indeed offer some added value, but also bears the risk of disorientation and stress which might transform ›extra value‹ to ›less value‹.
Die einleitende Aussage von Norbert Bolz steht synonym für viele andere ähnlich lautende Thesen von Medientheoretikern der frühen 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Dass die neuen Medien – »elektronische Digitalmedien, die an den Bildschirm als Repräsentationsform gebunden sind«[2] – über kurz oder lang das Buch als Informationsmedium überflüssig machen würden, war für die meisten von ihnen eine unvermeidliche Tatsache. Unterschiede gab es vor allem hinsichtlich der Bewertung dieser These. Einer der bekanntesten Vertreter des so genannten ›Medienpessimismus'‹ ist Neil Postman, der die Befürchtung äußerte, dass die neuen Medien nicht nur die bestehende Medienlandschaft erweitern, sondern dass sie sich grundsätzlich auf traditionelle Medien verdrängend auswirken. In der Konkurrenz um Zeit, Aufmerksamkeit, Geld und Ansehen werden sich die neuen Medien immer zu Lasten der alten Technologien durchsetzen. Darüber hinaus werde die Nutzung neuer Medien einen Prozess der Vereinsamung in Gang setzen. Auch in der deutschen Forschung wurde die Befürchtung aufgegriffen, dass »[d]ie Kinder der neuen Medienwelt [...] sich nicht mehr über Bücher [beugen], sondern [...] vor Bildschirmen [sitzen]«[3] werden.
Andere beurteilten diese Entwicklung dagegen als notwendig und begrüßenswert. Als Vorreiter dieser Medieneuphorie gilt Marshall McLuhan, der schon in den 60er-Jahren das Ende der – von ihm so genannten – ›Gutenberg-Galaxis‹ propagierte und als positiv bewertete. Das Buch sei monokausal und linear und wirke sich daher verengend auf das menschliche Bewusstsein aus. Elektronische Medien dagegen könnten den Menschen auf Grund ihrer Vielstimmigkeit aus dieser Einseitigkeit lösen und Kreativität und geistige Offenheit wecken. Diese Theorie wurde häufig auch in den 90er-Jahren mit der Einführung des Computers als Massenmedium wieder belebt. Medientheoretiker wie Jay David Bolter folgten zwar der McLuhan'schen These von der völligen Verdrängung des Buches nicht in seiner Radikalität, sahen aber das Buch nicht länger als das vorherrschende Medium für die Präsentation von Wissen an. Diese Funktion werde durch andere Medien übernommen, während das Buch als Gegenstand zur Befriedigung spezifisch luxuriöser Bedürfnisse weiter existieren werde. [4]
Im Prinzip lag also den meisten medientheoretischen Werken der 90er-Jahre die Hoffnung beziehugnsweise Befürchtung zu Grunde, die so genannten ›neuen Medien‹ werden lang-, wenn nicht sogar mittelfristig das Buch als Informations- und Unterhaltungsmedium an sich und damit auch das Lesen obsolet machen. Zu der Vorstellung, dass digitale Texte bisher Gedrucktes ersetzen könnten, gesellte sich einmal mehr sehr schnell die Befürchtung empirischer Medienforscher und Mediendidaktiker, diese neuen Medien könnten zu einem ›Fressfeind‹ des Buches avancieren. Schon beim Fernsehen ging man – in früheren Jahren – davon aus, dass dieses keine Zeit mehr für das Lesen lasse, und um so mehr befürchtete man dies nun bei Computern und dem Internet.[5] Bestimmend für die medientheoretische Diskussion ist also zunächst eine Ebene, die ich hier ›mediale Ebene‹ nennen möchte. Dabei handelt es sich um Theorien zur antizipierten Verdrängung von Buch und Lesen – Theorien also, die das Medium selbst in den Mittelpunkt der Diskussion stellen.
Gleichzeitig findet sich aber auch eine weitere Ebene, die ich als ›inhaltliche Ebene‹ bezeichnen möchte. Dabei handelt es sich um Theorien, die sich nicht primär mit den Medien selbst auseinandersetzen, sondern konkret mit den eigentlichen Medienprodukten. Im Falle der Hypertext-Forschung, auf die ich hier rekurriere, sind das also digitale Texte sowie die Frage nach ihrer Präsentation in den Bildschirmmedien, nach ihren Inhalten und ihren Funktionsweisen. Auch wenn die Hypertext-Forschung eher das Verhältnis von Literatur und neuen Medien betrachtet, bedeutet dies nicht, dass das Feld der Untersuchungen digitaler Texte prinzipiell auf rein literarische Texte beschränkt ist. Die Untersuchung von Veränderungen literaturwissenschaftlicher Grundkonstanten wie Autor, Leser und Text in Bezug auf diese Texte können jedoch als grundlegend für jegliche Art von digitalen Texten angesehen werden. Diskutiert werden hier vor allem Thesen der Auflösung der traditionellen Autorschaft, der Co-Autorschaft des Lesers sowie der Nicht-Linearität des Textes. Diese Theorien bauen häufig auf poststrukturalistischen Theorien zu Autorschaft, Leser und Text auf, die von den jeweiligen Autoren als fast schon prophetisch für die Betrachtungsweise digitaler Texte angesehen werden. [6]
Viele dieser Untersuchungen setzen sich in der Regel jedoch nur rudimentär mit den tatsächlich vorhandenen Medienprodukten auseinander. Stattdessen formulieren sie meistens normative und dogmatische Thesen, die nicht oder nicht ausreichend an der tatsächlichen Medienpraxis überprüft werden. Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis versucht vor allem die jüngere Forschung zu überwinden. Es geht ihr um die Frage, wie es denn tatsächlich um das Lesen und den Umgang mit Büchern in der gegenwärtigen Mediengesellschaft bestellt ist, ob man von Verdrängung oder gar Substitution sprechen kann. Es geht aber auch um die Wirklichkeit der Produktion und Rezeption von Medienprodukten. So soll weniger postuliert werden, was mit den neuen Medien theoretisch produziert werden könnte und welche Aussagen über Veränderungen literaturwissenschaftlicher Grundkonzepte daraus getroffen werden könnten. Viel relevanter sind die Fragen, was tatsächlich realisiert wird und welche Veränderungen tatsächlich auszumachen sind. Von Interesse ist darüber hinaus auch, welchen Stellenwert die Medienprodukte für die Nutzer haben, und wie mit ihnen und den neuen Medien im Allgemeinen umgegangen wird.
Diese Fragestellungen sind auch für den hier vorliegenden Beitrag von Interesse. Die oben angeführten Theorien über die Veränderungen von Buch und Lesen durch die Einführung neuer Medien sollen anhand von konkretem Datenmaterial untersucht und hinterfragt werden. Die Daten, auf denen dieser Beitrag basiert, stammen – soweit nicht anderweitig gesondert erwähnt – aus der Repräsentativstudie Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend der Stiftung Lesen aus dem Jahr 2000, an deren Konzeptionierung und Durchführung ich mitgewirkt habe. Es handelt sich bei dieser Studie um eine Untersuchung des Lese- und Medienverhaltens in Deutschland, die aus einem quantitativen und einem qualitativen Teil besteht. Die Basis für den ersten Teil bildeten 2550 in Deutschland lebende Probanden ab vierzehn Jahren. Für den qualitativen Teil der Studie wurden zusätzlich 120 in Deutschland ansässige Personen ab vierzehn Jahren in ein- bis anderthalbstündigen narrativen Interviews zu ihrem Lese- und Medienverhalten befragt. Aus dem dementsprechend umfangreichen Datenmaterial kann an dieser Stelle nur ein kleiner Ausschnitt wiedergegeben werden. Für weitere Ergebnisse aus der Gesamtstudie verweise ich auf den im Rahmen der Studie publizierten Band Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend.[7]
In einem ersten Teil dieses Beitrages soll zunächst der Frage nach der Verdrängung des Mediums Buch sowie des Lesens durch die neuen Medien nachgegangen werden (Kapitel I.1). Im Anschluss daran sollen kurz die oben bereits angesprochenen Theorien zur Veränderung literaturwissenschaftlicher Grundkonzepte in digitalen Texten aufgeführt und überprüft werden (Kapitel I.2). Dabei soll der Schwerpunkt der Betrachtung hier, wie im gesamten Beitrag, eher auf die möglichen Veränderungen der Rezeption digitaler Texte (Text und Leser) als auf die Produktion derselben (Text und Autor) gelegt werden.[8] Von Interesse ist dabei vor allem, ob der in der Hypertext-Forschung postulierte so genannte ›Mehrwert‹, den der Leser von Hypertexten gegenüber dem Leser von linearen Texten aus dem jeweiligen Leseakt angeblich zieht, tatsächlich als solcher vom Leser wahrgenommen wird.
In einem zweiten Teil möchte ich verschiedene Aspekte des ›Lesens am Computer‹ betrachten (Kapitel II.): Wer liest überhaupt am Bildschirm (Kapitel II.1) und wie sieht dieses Lesen aus (Kapitel II.2)? Welche Unterschiede beziehungsweise Parallelen lassen sich im Hinblick auf die Rezeption gedruckter Texte ausmachen? Welche Lesestrategien werden entwickelt, und wie ist die Selbsteinschätzung im Umgang mit der neuen Leseoberfläche?
Die einen sehen das Buch und seine Kultur als die eigentliche Grundlage unserer intellektuellen Zivilisation, den anderen gilt es als gerade hemmend für das Fortschreiten derselben, weil es – so wie von Marshall McLuhan formuliert – durch seine lineare Ausrichtung das Denken einenge und durch die Verschriftlichung von Kommunikation die Gesellschaft zersplittere. Während die einen die Befähigung zu Objektivität sowie logischem und eigenständigem Denken als (vermeintliche) Folgen der Buchkultur hervorheben,[9] erhoffen sich die anderen von der Einführung neuer Medien eine Auflösung des linearen Denkens zu Gunsten von assoziativerem Denken sowie das Vernetzen der Gesellschaft zu einem »globalen Dorf«[10] und dadurch auch einen demokratischeren Zugang zu Wissen.
Häufig sind dabei in der Diskussion um die Veränderungen, die durch die Einführung der neuen Medien auftreten, die Grenzen zwischen den beiden bereits angesprochenen Ebenen recht fließend. So werden etwa, ausgehend von den technischen Gegebenheiten des Mediums selbst, Rückschlüsse über die Möglichkeiten der jeweiligen Medienprodukte gezogen, oder man spekuliert über ein potentielles Leserverhalten allein auf Grund gegebener technischer Möglichkeiten. Auch in den Äußerungen der Befragten in unserer Repräsentativstudie ist zu beobachten, dass eine solche Trennung – so notwendig sie für eine theoretische Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist – immer nur künstlich sein kann. So antworteten die Befragten auf die Frage nach der Zukunft des Computers, die sich sowohl auf das Medium an sich als auch die inhaltliche Entwicklung bezog, häufiger nur in Bezug auf die ›mediale Ebene‹.
Ja, ich schätze, dass das immer mehr wird und sich immer mehr entwickelt und dass es auch die Schulen immer mehr kriegen, so dass es schon undenkbar ist, wenn man es nicht in der Schule als Fach hat. Also, so stelle ich mir vor wird es auf jeden Fall werden. Das sieht man ja jetzt schon, dass die Kleinen aus der Grundschule schon mit Computern umgehen können. (weiblich, 23 Jahre, Fallnummer 167)
Ebenfalls fließende Grenzen lassen sich bei der Beschreibung von Lesehindernissen am Bildschirm ausmachen. Viele Befragte nennen hier mentale Nachteile, die sie beim Lesen am Computer empfinden – man kann nicht so einfach auf soeben Gelesenes zurückgreifen, weil es bereits ›weggeklickt‹ ist – im gleichen Atemzug mit physischen Hemmnissen, wie zum Beispiel flackernde Bildschirme, die Sehschwierigkeiten verursachen.
Dass man gewisse Inhalte sofort wieder aufschreiben kann, dass man den Blick nach oben frei halten kann. Dass man noch mal was nachlesen kann, was man nicht verstanden hat. Das geht eben schneller als im Bildschirm. Und Bildschirm, je nach dem wie alt die sind, dann flackern die auch noch. Dann kriegt man rote Augen davon. (männlich, 24 Jahre, Fallnummer 76)
Im Bewusstsein der Menschen bedingen sich diese beiden Ebenen durchaus gegenseitig oder sind häufig in letzter Konsequenz nicht zu trennen. Im Folgenden soll diese Trennung jedoch auch deshalb vorgenommen werden, um eventuell unrichtigen Schlussfolgerungen vorzubeugen. Gemeint sind damit etwa solche Theorien, in denen behauptet wird, jeder Hypertext lasse eine Interaktion zwischen dem Autor und dem Leser zu, nur weil das Medium Computer prinzipiell eine Kommunikation zwischen dem Hersteller eines Textes und seinem potentiellen Leser ermöglicht.
Die Basis aller Theorien über die Auswirkungen der neuen Medien auf die Kultur ist sehr durchgängig die Befürchtung beziehungsweise die Hoffnung, dass das Ende der Buchkultur und des Mediums Buch als solches bevorsteht. Unterstützt und angeheizt wurde diese Diskussion Ende der 90er-Jahre dann vor allem durch das Aufkommen so genannter E-Books und des E-Papers. Diese machen nicht nur eine Digitalisierung von Text möglich, sondern ahmen auch das jeweilige traditionelle Format (Buch und Papier, hier: das Layout der Zeitung) nach, treten also zusätzlich durch ihre Präsentationsform in Konkurrenz zum Gedruckten. Diese Formen bieten eine Antwort auf das Argument, digitaler Text am Computer-Bildschirm könne ein Buch oder eine Zeitung allein schon auf Grund der fehlenden Transportierbarkeit oder Handhabbarkeit nicht ersetzen. Digitale Texte in dieser Form kann man auch ohne größeren Aufwand in der Bahn oder im Bett lesen. Die Entwicklung von E-Books und E-Paper stützt damit die These, dass jedes Druckerzeugnis langfristig durch ein digitales Äquivalent ersetzt werden kann.[11]
Die aktuellen Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Informationsvermittlung durch das Internet bereits einen recht hohen Stellenwert einnimmt. Fast 40 Prozent der Deutschen nutzen inzwischen einen Computer und etwa drei Viertel dieser Gruppe nutzen auch das Internet regelmäßig.[12] Trotzdem konnten auch zu Beginn des neuen Jahrtausends keine Rückgänge in der Buchproduktion oder im Buchverkauf festgestellt werden. Der deutsche Buchmarkt verzeichnet für das Jahr 2000 sogar ein Wachstum von 2,1 Prozent sowie eine Steigerung um 2,7 Prozent bei der Zahl der Neuerscheinungen im Vergleich zum Vorjahr.[13]
Die genannten Studien tragen auch dazu bei, die Befürchtungen der empirischen Medienforscher und Mediendidaktiker zu widerlegen, Computer und Internet seien ›Fressfeinde‹ des Lesens. Ähnlich wie in den vergangenen Jahrzehnten bezüglich des Fernsehens, wurde und wird angenommen, der Computer und das Internet könnten das Interesse für Bücher und das Lesen, auf jeden Fall aber die für das Lesen aufgewandte Zeit einschränken. Diese Befürchtung erweist sich als (zurzeit jedenfalls) nicht zutreffend. Dies lässt sich an verschiedenen Faktoren festmachen. Einer davon ist, dass Bücher und Lesen nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen. 40 Prozent aller Befragten halten das Lesen von Sachliteratur und Fachbüchern für wichtig und selbst Belletristik wird von jedem Dritten als wichtig eingestuft. Die Nutzung des Computers und des Internets werden als vergleichsweise weniger wichtig eingeschätzt. Nur etwa jeder Sechste hält Computer und Internet für sehr wichtig oder wichtig. Allerdings muss eine Veränderung der Stellenwerte dieser Medien bei Jugendlichen unter zwanzig Jahren angenommen werden. Die Ergebnisse der PISA-Studie 2001 lassen darauf schließen, dass die Generation der heute unter 20-jährigen, die in ihrer Mediensozialisation bereits mit einer selbstverständlichen Nutzung von Computer und Internet aufgewachsen ist, andere Gewichtungen vornehmen würde.[14]
Auch der Befürchtung, die rasante Entwicklung der neuen Medien werde dazu beitragen, dass man sich keine Zeit mehr für das Lesen nimmt, kann entgegen getreten werden. Generell kann ein Zuwachs beim Anteil der so genanten ›Vielleser‹ an der Bevölkerung ausgemacht werden, während die so genannten ›Wenigleser‹ einen Rückgang verzeichnen. Immer mehr Menschen lesen also viel, wenn sie lesen. Dabei wird zwar insgesamt seltener gelesen – man liest nicht mehr täglich, sondern nur noch an ein paar Tagen in der Woche –, in dieser Zeit dafür aber deutlich mehr Bücher. Lesen bleibt also eine wichtige Aktivität, wird aber – sehr wahrscheinlich auf Grund des gestiegenen Medienangebots – konzentrierter und trotzdem unvermindert genutzt.[15]
Dies zeigt sich auch, wenn man Vergleichswerte der Studie zum Leseverhalten in Deutschland der Stiftung Lesen aus dem Jahr 1992 betrachtet.[16] Natürlich sticht dabei die Nutzungsdauer für Computer und Internet deutlich hervor, weil es entweder – wie beim Internet, das erst nach 1992 zum Massenmedium wurde – keinerlei Vergleichswerte gibt oder, weil die Steigerung – wie beim Computer – proportional besonders hoch ist, weil dieser zwar bereits 1992 genutzt wurde, jedoch noch kein Massenmedium war. Während auf die Nutzung des Computers 1992 nur etwas mehr als eine Stunde pro Woche verwandt wurde, verbringen wir heute durchschnittlich schon dreieinhalb Stunden pro Woche vor dem Computer und im Internet.[17] Dieser zusätzliche Zeitaufwand scheint keinen besonders deutlichen Einfluss auf die Zeit zu haben, die für das Lesen genutzt wird. Ein Rückgang ist allenfalls im Bereich der Belletristik und Unterhaltungslektüre zu verzeichnen, ob dies jedoch ein kausaler Zusammenhang ist, ist den Daten generell nicht zu entnehmen. Für das Lesen von Romanen werden im Durchschnitt zwanzig Minuten weniger pro Woche (140 Minuten pro Woche) aufgewendet als noch 1992 (163 Minuten). Dieser Rückgang ist allerdings ein Trend, der sich auch schon in den Jahren vor der Einführung von Computer und Internet abgezeichnet hat.[18] Hingegen ist der Zeitaufwand für Sach- und Fachlektüre um einige Minuten auf über anderthalb Stunden pro Woche gestiegen.
Wenn Computer und Internet verdrängend wirken, dann eher in Bezug auf die Zeit, die für andere audiovisuelle Medien wie Fernsehen und Radio aufgewandt wird. Auch hier muss darauf verwiesen werden, dass es sich um Korrelationen handelt, deren Kausalität auf Grund möglicher Drittvariablen nicht grundsätzlich feststellbar ist. Im Durchschnitt werden im Vergleich zu 1992 jeweils über zwei Stunden weniger fern gesehen und Radio gehört. Prozentual gesehen ist dieser Rückgang (zehn Prozent) zwar geringer als der beim Zeitaufwand für Belletristik (vierzehn Prozent); berücksichtigt man jedoch, dass die Nutzungsdauer dieser Medien bisher immer stark ansteigend war,[19] gewinnt diese Beobachtung an Bedeutung. Die neuen Medien nehmen unsere Zeit in Anspruch, ihre Nutzung geht aber offensichtlich stärker zu Lasten von Medien, die bis zur Etablierung von Computern und Internet als die eigentliche Konkurrenz der Printmedien und des Lesens galten.
Der These von der scharfen Konkurrenz zwischen dem Lesen und der Nutzung anderer Medien lässt sich auch durch eine weitere Beobachtung entgegentreten. Bereits in Bezug auf das Fernsehen konnte konstatiert werden, dass Lesen eine Grundlage für den kompetenteren Umgang mit diesem Medium liefert.[20] Die Korrelation von Lesekompetenz und allgemeiner Medienkompetenz gilt auch für die Nutzung von Computer und Internet. Menschen, die täglich oder mehrmals in der Woche lesen (›Vielleser‹) zeigen einen kompetenteren Umgang mit dem Computer und anderen Medien als Menschen, die wenig oder gar nicht lesen (›Wenigleser‹).[21] Fast zwei Drittel aller Vielleser sind Computernutzer, während nur achtzehn Prozent der Wenigleser einen Computer nutzen. Umgekehrt sind Computernutzer auch häufiger Leser als Menschen, die den Computer nicht nutzen. Drei Viertel aller Computernutzer lesen, zwei Drittel sind sogar Vielleser. Auch halten Computernutzer Lesen für wichtiger als Nicht-Computernutzer. 60 Prozent aller Computernutzer halten Fach- und Sachbücher für sehr wichtig oder wichtig; bei den Nicht-Computernutzern sind es nur 26 Prozent. 37 Prozent halten Belletristik für wichtig; bei den Nicht-Computernutzern sind es nur 24 Prozent. Computernutzer kaufen mehr Bücher, empfinden weniger Lesehindernisse und verfügen über kompetentere Lesestrategien, zum Beispiel die Fähigkeit zum selektiv-zielgerichteten Lesen.
Das entspricht auch der Selbsteinschätzung der Befragten – unterteilt in Viel- und Wenigleser – in Bezug auf das Lesen am Bildschirm. Vergleiche dazu folgende Tabelle:
|
|
erhalte guten
Überblick
|
fühle mich nicht über- |
vergesse nicht, |
bleibe bei |
|
Vielleser |
78% |
70% |
63% |
37%
|
|
Wenigleser |
59% |
52% |
51% |
52% |
Vielleser haben weniger Schwierigkeiten als Wenigleser mit der Tatsache, dass Texte nicht mehr auf einer einzigen Oberfläche präsentiert werden, sondern sie diese ›zusammenlesen‹ müssen. Sie sind zielgerichteter und konzentrierter in ihrer Informationssuche, das heißt, sie verfolgen auch in der Informationsflut des Internets ein einmal anvisiertes Ziel. Darüber hinaus sind sie aber auch weniger ängstlich im Umgang mit den Informationsmassen und lassen sich durch Links auf verwandte Themen verweisen, ohne dabei den Überblick zu verlieren, und dies, obwohl dem Leser »als informationsverarbeitende[m] System [...] nur begrenzte kognitive Kapazitäten zur Verfügung stehen«.[22]
Von einer Verdrängung des Buches – vor allem aber des Lesens – kann zumindest mittelfristig nicht die Rede sein. Mediennutzung und Lesen stehen in Bezug auf die Nutzungskompetenz in einem positiven Verhältnis zueinander. Kompetente Mediennutzung, so kann man festhalten, basiert – soweit man solche Kausalaussagen machen kann – häufig auf einer gelungenen Lesesozialisation. Ließe die Beschäftigung mit Computer und Internet also tatsächlich keine Zeit mehr für das Lesen, würde sich das eindeutig negativ auf die Kompetenz im Umgang mit den neuen Medien auswirken.
In der medientheoretischen Diskussion um Vor- und Nachteile digitaler Medien und Medienprodukte – in diesem Fall Hypertexte beziehungsweise literarische Hypertexte – begegnen einem immer wieder Thesen, die sich mit dem Status des Autors, des Lesers und des Textes beziehungsweise seiner Strukturierung beschäftigen. Der Grundtenor fast aller Thesen und Theorien lässt sich wie folgt – etwas pauschalisiert[23] – zusammenfassen: Die traditionelle Form der Autorschaft ist überkommen, der Leser avanciert auf Grund dessen zum Co-Autor eines Textes, dessen ›traditionelle‹ lineare Form ebenso überkommen ist wie sein Autor. Die nicht-lineare beziehungsweise vernetzte Ordnung des Textes erlaubt es dem Leser, assoziativ seinen ganz persönlichen Text zusammenzustellen, ohne dabei auf die Führung oder Sinnstiftung des Autors angewiesen zu sein beziehungsweise von ihr beeinflusst zu werden.
Diese Aussagen sind zumeist der – inzwischen von der jüngeren Forschung immer häufiger so benannten – ›Konvergenz-These‹ zuzuordnen. Diese postuliert den Hypertext als die ideale Textform zu Fortführung beziehungsweise Verwirklichung poststrukturalistischer Theorien zu Autor-, Leser- und Textkonzepten. Stellvertretend für diese These sei hier wiederum auf George P. Landow verwiesen:
[...] hypertext has much in common with some major points of contemporary literary and semiological theory, particularly with Derrida's emphasis on de-centering and with Barthes's conception of the readerly versus the writerly text. In fact, hypertext creates an almost embarrassingly literal embodiment of both concepts [...].[24]
Roland Barthes sprach – in prä-hypertextuellen Zeiten – vom zwangsläufigen »Tod des Autors«, um »[d]ie Geburt des Lesers [...] zu bezahlen«[25] und subsumierte damit ähnlich lautende Theorien anderer poststrukturalistischer Autoren zu einer schlagkräftigen und oft zitierten Aussage. Der Autor wird demnach nicht länger als motiviertes Subjekt angesehen, sondern als eine Funktion des Textes unter vielen. Er hat also als Urheber und Sinnstifter des Textes ausgedient und wird nur noch als Lieferant von Textmaterial angesehen. Damit wird der Text befreit von einem einzigen und autorzentrierten Sinn und kann als offen für »plurale Lektüren« (Eco) angesehen werden. Der Leser ist somit nicht mehr länger hermeneutischen Interpretationszwängen unterworfen. Stattdessen entsteht die Bedeutung des Textes – beziehungsweise der Text selbst – erst im Leseakt durch den Leser.
Übergreifend für die Diskussion um die Konzepte von Autor, Leser und Text in den digitalen Medien ist also der Aspekt der (räumlichen) Organisation von Text, in diesem Fall die Nicht-Linearität. Die Andersartigkeit der Präsentation von Text beziehungsweise Texteinheiten in digitalen Medien ist es, die die Betrachtung von Veränderungen in der Produktion und Rezeption dieser Texte ermöglicht beziehungsweise erforderlich macht. Zu Beginn einer Betrachtung dieser potentiellen beziehungsweise proklamierten Veränderungen muss also die Betrachtung des anders strukturierte Textes selbst, des Hypertextes, stehen. Was ist Hypertext und wie unterscheidet er sich von so genannten ›linearen Texten‹? Diese Differenz bildet dann die Grundlage für die Annahme von beziehungsweise Forderung nach veränderten Autor- beziehungsweise Leserkonzepten und soll im nachfolgenden Kapitel näher betrachtet werden.
Hypertexte bestehen aus so genannten ›Knoten‹ (Informationseinheiten), die wiederum über Links (Verweise) auf eine nicht-lineare Weise miteinander verbunden sind, das heißt, die einzelnen Knoten des Hypertextes sind rhizomartig – also weder linear noch hierarchisch – untereinander verbunden und sind, selbst wenn sie in einem logischen (eventuell auch inhaltlich linearen) Zusammenhang stehen, nicht gleichzeitig auf einer Oberfläche zu sehen.[26] Obwohl es natürlich auch Hypertexte in gedruckter Form gibt,[27] soll in diesem Beitrag nur der digitale Hypertext betrachtet werden. Von einem gedruckten Text unterschiedet sich der digitale Hypertext also vornehmlich in der Organisation seiner Texteinheiten sowie durch die Oberfläche, auf der präsentiert wird.
Alle Texteinheiten eines gedruckten (linearen) Textes werden auf einer einzigen Oberfläche präsentiert. Für den Leser bedeutet dies, dass er auf einen Blick Informationen über den Umfang und die Anordnung des Textes erhält. Im Hypertext sind dagegen die einzelnen Textteile nicht auf einen Blick ersichtlich und der Leser hat keinen Überblick über Umfang und Anordnung des Textes. Dafür hat er im Hypertext die Möglichkeit, sich die verschiedenartigen Informationseinheiten, auf die jeweils verwiesen wird, sofort in ein und demselben Medium anzusehen. Dabei kann es sich um weiterführenden Text in Form von Fußnoten, aber auch um Bilder oder Audio- und Videoelemente handeln. Er muss dafür nicht, wie der Leser eines gedruckten Textes, auf andere Medien zurückgreifen.
Die fehlende fixierte Anordnung der Textteile im Hypertext erfordert vom Leser Entscheidungen über die Kombination eben dieser Einzelteile zu einem individuellen und – eventuell erneut – linearen Ganzen. Da ein Verfolgen der einzelnen Teile nur auf Grund von Entscheidungen im Lesevorgang möglich ist, eine Entscheidung also getroffen werden muss, um weiterzukommen, wird dem Leser die Option genommen (die er im linearen Text hat), entweder der vorgegebenen Anordnung der Textteile durch den Autor zu folgen oder sich innerhalb dieser fixierten Anordnung doch für einen eigenen Leseweg zu entscheiden.
Trotzdem wird allgemein von der Befreiung des Lesers durch die Nicht-Linearität gesprochen. Es heißt, der Leser sei nicht mehr länger gefangen in einem in sich geschlossenen Text, dessen Rezeption ihm durch die Organisation der Texteinheiten und damit die damit assoziierte Sinngebung des Autors vorgegeben werde. Stattdessen finde er viele einzelne Texteinheiten, die in sich jeweils abgeschlossen sind, aber ständig über sich hinaus auf andere mit ihnen zusammenhängende oder assoziativ verbundene Texteinheiten verweisen. Es biete sich ihm ein Vorrat von Mosaiksteinen, die er nach seinen Vorstellungen zusammensetzen könne. Es sei seine Wahl, über die Zusammenstellung der Texteinheiten, über Form, Länge und Inhalt ›seines‹ Textes zu entscheiden. Der Autor werde zum Schreiber[28] degradiert, der nur Textmaterial liefere und somit seine ›Macht‹ über Organisation und Bedeutung des Textes an den Leser abgebe. Der Leser übernimmt damit – so die Theorie – die Funktion eines Co-Autors beziehungsweise eines so genannten »Wreaders«.[29] Eine solche ›Autorfunktion‹ wird ihm häufig auch deshalb zugeschrieben, weil man davon ausgeht, dass der Leser aktiv und verändernd in den digitalen Text eingreifen kann. Die wenigsten Hypertexte lassen jedoch solche, den eigentlichen Text verändernde Eingriffe zu. Der Leser wird also nur in seinem persönlichen Text zum Co-Autor.
Die Befreiung des Lesers wird auch regelmäßig angeführt, wenn es um den so genannten ›Mehrwert‹ des Hypertextes gegenüber dem traditionell linearem Text geht. Es wird postuliert, der Hypertext biete dem Leser unter verschiedensten Aspekten Vorteile, die er so in einem gedruckten Text nicht finde. In einer der Thesen wird formuliert, der Hypertext habe einen Mehrwert gegenüber dem gedruckten Text, weil er eben in seiner assoziativen Vernetztheit der Struktur des menschlichen Gedächtnisses beziehungsweise der menschlichen Wissensverarbeitung und Wissensspeicherung entspreche. Die Annahme, dass menschliches Wissen in nicht-linearen Strukturen organisiert ist, wird jedoch von der jüngeren Forschung inzwischen stärker relativiert.[30] Eine zweite These begründet den Mehrwert eines Hypertextes damit, dass im Hypertext verschiedenste Informationen und Medien auf nur einer Oberfläche gebündelt werden und jederzeit ortsunabhängig abrufbar sind. Die Schnelligkeit und Unmittelbarkeit, mit der der Leser auf Informationen verschiedenster Medien zugreifen kann, ist sicherlich ein unanfechtbarer Vorteil des Hypertextes. Problematischer scheint eben die These zu sein, die den Mehrwert des Hypertextes auf Grund der Befreiung des Lesers postuliert. Der Hypertext biete dem Leser mehr Entscheidungsfreiheit und Eigenständigkeit in der Interpretation, so dass diesem das Gefühl vermittelt werde, ›Herr‹ über den Text zu sein.
Eine oberflächliche Betrachtung des Prinzips Hypertext – das heißt zur Verfügung gestelltes Textmaterial kann vom Leser in beliebiger Reihenfolge zu einem für ihn stimmigen Gesamttext zusammengestellt werden – stützt diese These möglicherweise zunächst. Aber selbst wenn der Leser einen Mehrwert daraus zieht, selbst über Anordnung und Inhalt ›seines‹ Textes entscheiden zu können, ist dies kein Merkmal, das nur dem Hypertext eigen ist. Auch im gedruckten Text muss der Leser Leerstellen auffüllen und sich so von der rein rezipierenden Funktion innerhalb des Gefüges von Autor, Leser und Text lösen. Auch hier wendet er Strategien an, die ihm einen individuellen Leseweg ermöglichen. Gemeint sind damit Vorgehensweisen wie zielgerichtet selektives Lesen, so genanntes ›Querlesen‹ oder das Lesen von Fußnoten.
Es muss aber auch angezweifelt werden, ob der Leser tatsächlich einen Mehrwert durch die ›neue‹ Entscheidungsfreiheit erhält. Denn einerseits erhält er zwar Entscheidungsfreiheit, andererseits wird er gleichzeitig mit mehr Zwängen und Verantwortung konfrontiert. Wie oben bereits ausgeführt, hat auch der Leser eines linear strukturierten Textes die Möglichkeit, vom vorgegebenen Leseweg abzuweichen, indem er zum Beispiel einzelne Passagen überspringt oder das Ende zuerst liest. Das Neue am Lesen in einem Hypertext ist also nicht, dass der Leser ganz neue Entscheidungsmöglichkeiten hat, sondern die Tatsache, dass er sich entscheiden muss. In einem nicht-linear strukturierten Text ist ihm die Möglichkeit genommen, einen Text ›entscheidungsfrei‹ zu lesen.[31] Diese Entscheidungsfreiheit kann also auch als Entscheidungszwang aufgefasst und empfunden werden. Der Leser kann sich also einem Druck ausgesetzt fühlen, der ihn eventuell vom Weiterlesen abhält.
Der Hypertext scheint aber auch prädestiniert dafür, Verwirrung beim Leser zu stiften. Zunächst einmal fehlt dem Leser eines Hypertextes ja der Überblick über den Gesamtkorpus an Texteinheiten beziehungsweise anderen, dem Hypertext zugeordneten Elementen wie Audio- oder Videoelemente, Bildmaterial oder Grafiken. Ohne einen Überblick über das prinzipiell zur Verfügung stehende Material ist ein Abschätzen des individuell effektivsten Lesewegs nicht möglich. Zusätzlich enthält ein Hypertext auch externe Links über das eigentliche Textmaterial hinaus, die ein Einschätzen des möglichen Umfangs der Lektüre noch schwerer machen. Eine fehlende Übersicht über die potentielle Lesemenge schreckt unter Umständen noch vor dem Beginn der Lektüre vom Lesen ab, kann aber auch im Leseakt selbst noch zu Verwirrung führen. Das passiert, wenn man sich über die momentane Position im Text nicht im Klaren ist, man den Lesestoff in Umfang und Inhalt nicht einschätzen kann oder wenn nicht absehbar ist, wann ein (vorgesehenes und nicht vom Leser abrupt herbeigeführtes) Ende zu erwarten ist. Das Phänomen der Verwirrung durch fehlenden Überblick wird in der Forschung sowie in den Medien oft plakativ als ›Lost in Hypertext‹ bezeichnet. Hinzu kommt, dass dem Hypertext auch Mittel der Strukturierung fehlen, wie wir sie aus unserer bisherigen Lesesozialisation kennen. Gedruckte Texte bieten Orientierung in Form von Seitenzahlen, Inhaltsverzeichnissen oder Kapiteln, die im Hypertext so nicht oder nur ansatzweise vorhanden sind.[32]
Problematisch ist bei der erzwungenen Entscheidung über einen Leseweg im Hypertext auch, dass der Leser sich über seine Konsequenzen im Klaren sein muss. Was verpasst er, wenn er sich für einen von zwei Links innerhalb eines Knotens entscheidet? Wird ihm die Möglichkeit geboten, diese ›verpassten‹ Informationen innerhalb des selben Leseaktes noch einmal aufzugreifen oder muss er dafür wieder neu anfangen? In einem linearen (gedruckten) Text ist diese Entscheidung übersichtlicher, weil man den Zeitpunkt, zu dem die zuvor ausgelassene Option gelesen wird, selbst bestimmen kann. Das Verfolgen des bereits zurückgelegten Lesewegs ist auch im Hypertext möglich; über die »Back«-Taste beziehungsweise »Forward«-Taste lässt sich das bereits Gelesene noch einmal reproduzieren. Allerdings bieten auch die Funktionen dieser Tasten nicht die Möglichkeit, alle rezipierten Textteile zu einem Gesamttext auf der Bildschirmoberfläche zusammenzuführen, um sich den Text als Ganzes vor Augen zu führen.
Problematisch ist auch die häufig angeführte Umverteilung von ›Macht‹ zwischen Autor und Leser. Die Macht über die Entscheidung der Textgestaltung, die der Autor dem Leser angeblich überlässt, überlässt er diesem nur scheinbar. Vielmehr hat der Autor, auch wenn er vielleicht auf der Oberfläche des Textes nicht mehr präsent ist, eine nicht sichtbare Macht über die Textgestaltung und somit auch über den Leser. Dem Autor kommt nämlich im Hypertext eine doppelte Funktion zu; er schreibt nicht nur den Text, den der Leser später auf seinem Bildschirm lesen kann, sondern auch den ›Untertext‹, also die Anweisungen für die Präsentation beziehungsweise Vernetzung der Textteile in HTML. Dieser Text ist für den Leser nicht sichtbar, sondern nur in seinen Auswirkungen wahrnehmbar. Auf dieser Ebene hat der Autor immer noch eine Form der Macht, wenn nicht sogar mehr als zuvor. Er kann Befehle einbauen, die den Leser zwangsläufig auf bestimmte Textelemente führen oder auch kausal bedingte Befehle, die ein Weiterkommen erst nach der Erfüllung bestimmter – möglicherweise nicht als solche gekennzeichneter – Bedingungen durch den Leser möglich machen. Diese Eingriffsmöglichkeiten des Autors im Hypertext lassen die postulierte Macht des Lesers schnell wieder als sehr viel weniger bedeutsam erscheinen. Der Leser hat immer nur so viel Macht oder Freiheit wie ihm vom Autor zugestanden wird – er kann nur das lesen, was er vorfindet. Der Autor lässt zwar eine Entscheidung über den Leseweg zu, begrenzt diese Freiheit aber gleichzeitig durch die vorgegebene Textmenge und durch mögliche unsichtbare Vorgaben. Selbstbestimmtes Handeln bleibt dann häufig nur auf ein bewusstes Abschalten beschränkt.
Ein weiteres Problem, das aus der nicht-linearen und nicht zeitgleichen Anordnung von Texteinheiten erwachsen könnte, ist neben Verwirrung und dem Druck des Entscheidungszwanges auch Langeweile. Zum einen kann Lesen in Hypertexten enorm redundant sein. Der fehlende Überblick über die tatsächliche Anzahl der Texteinheiten und ihrer Anordnung erhöht die Wahrscheinlichkeit, auf bereits gelesene Textteile zu stoßen. Zum anderen kann Langeweile auch durch fehlende Spannungsbögen entstehen. Der immer wiederkehrende Zwang zur Entscheidung unterbricht den Textfluss nicht nur mental, sondern auch physisch, indem die Maus oder die Computertastatur betätigt werden muss. Gerade im literarischen Bereich kann die Wirksamkeit eines Spannungsbogens dadurch leiden, da die Textualität immer bewusst bleibt und ein Abtauchen in den fiktionalen Text schwer fällt.[33]
Der proklamierte Mehrwert, den das Lesen von Hypertexten auf Grund neu gewonnener Freiheit für Leser haben soll, kann also auch in das Gegenteil verkehrt werden. Die schnelle und problemlose Verkettung von Informationseinheiten zu einer individuellen Gesamtinformation bietet zunächst einen offensichtlichen Mehrwert. Digitale Internettexte bieten Informationen unabhängig von Zeit und Ort, die – je nach Aufbereitung des Materials – auch problemlos eine Ausweitung der Informationssuche zulassen. Der Mehrwert eines Hypertextes geht aber dann verloren und gestaltet sich eher als ›Wenigerwert‹, wenn die nicht-lineare und nicht gleichzeitige Präsentation der Textelemente zu Verwirrung, Irritation, einem Gefühl der Überforderung oder gar der Langeweile führt.[34]
Die Rezeption von Informationen an Computerbildschirmen erfolgt zu einem Großteil lesend. Bei vielen Menschen ruft die Kombination von Lesen und einem sehr technischen Medium jedoch Irritationen hervor. Das liegt möglicherweise daran, dass der Akt des Lesens in unserer Gesellschaft in einer durchaus ›bildungsbürgerlichen‹ Sicht noch immer mit dem Lesen von Literatur verbunden wird. Und diese wiederum wird mit ›schönen‹ Büchern in Zusammenhang gebracht. Lesen und ein technisches Medium wird als nicht zusammengehörig empfunden und dies sowohl auf physischer als auch auf mentaler Ebene. Dabei umfasst der Akt des Lesens weitaus mehr als nur Literatur. Gerade in der Leseforschung ist umstritten, wo ›das Lesen‹ anfängt und wo es aufhört. Kann man schon das Blättern in Büchern als Lesen bezeichnen? Wie viel Text muss ›gelesen‹ werden, um vom Lesen sprechen zu können? Diese Diskussion soll hier nicht fortgeführt werden, auch wenn sie sich für die Untersuchung von Lesestrategien am Bildschirm fast identisch wiederholen ließe: Kann man Surfen im Internet als Lesen betrachten? Zählt das kurze Anklicken und Überfliegen einer Information zum Lesen? Für diesen Beitrag soll der Hinweis darauf genügen, dass auch Lesen am Bildschirm nicht nur Lesen von Literatur meint.
Von Interesse ist in diesem Beitrag vor allem, wie die Rezeption am Bildschirm, speziell das Lesen digitaler Texte, vom Leser wahrgenommen wird, und wie sie von den Beteiligten bewertet wird. Nehmen Bildschirmleser den proklamierten Mehrwert der digitalen Hypertexte als solchen wahr? In den nachfolgenden Kapiteln sollen die vorgenannten potentiellen Probleme bei der Rezeption von Hypertexten am Bildschirm unter Einbezug des quantitativen und qualitativen Datenmaterials tiefergehend betrachtet werden.
Die Auswertungen der Daten der quantitativen Studie im Rahmen der oben bereits angeführten Studie der Stiftung Lesen ergeben, dass annähernd jeder zweite Computernutzer täglich oder mehrmals in der Woche (im Folgenden ›häufig‹) am Bildschirm liest. Dass dies verstärkt Jugendliche und junge Erwachsene unter 30 Jahren tun, ist wohl ihrer bereits veränderten Mediensozialisation zuzuschreiben. Über die Hälfte der jüngeren Computernutzer lesen häufig am Bildschirm, während es im höheren Alter nur noch jeder Dritte tut. Eine ähnliche Differenz lässt sich zwischen Männern und Frauen ausmachen. Jeder zweite männliche Computernutzer liest häufig am Bildschirm, aber nur etwa jede dritte Computernutzerin. Auch in Bezug auf Computernutzung und Bildung lässt sich eine Aufwärtsbewegung beobachten. Je höher die Computernutzer gebildet sind, desto eher lesen sie auch am Bildschirm. Über die Hälfte aller Computernutzer mit Abitur, 40 Prozent aller Computernutzer mit einem Abschluss einer weiterführenden Schule und nur jeder dritte Computernutzer mit Hauptschulabschluss lesen am Bildschirm. Der typischen Bildschirmleser ist demnach – ähnlich wie der »typische Computernutzer«[35] – eher ein Mann, ist eher jünger und hat häufig eine höhere Ausbildung durchlaufen. In diesen Ergebnissen spiegeln sich ganz zwangsläufig Aussagen, die man über Computernutzer im Allgemeinen treffen kann, da nur diese die Voraussetzung für das Lesen am Bildschirm – nämlich die Nutzung eines Computers, die wiederum nur über den Bildschirm laufen kann – mitbringen.
Rein statistisch gesehen sind Männer also eher Computernutzer als Frauen. Dies mag möglicherweise darin begründet sein, dass Männer offensichtlich immer noch häufiger in Berufen arbeiten, die den Einsatz eines Computers erfordern. Die frühe Sozialisation mit Computer und Internet, die häufig an keinerlei (berufliche) Zwänge gebunden ist, verschafft der Generation der unter 30-jährigen – und hier vor allem den heute unter 20-jährigen – einen enormen Wissensvorsprung. Dieser ist deshalb so groß, weil er meist spielerisch angeeignet wurde und somit ein größeres Selbstverständnis im Umgang mit dem Medium mit sich bringt. Von Bedeutung ist sicher auch, dass der Computer einerseits ein in der Anschaffung nicht ganz billiges Gerät ist – man kann ihn also eher in Haushalten mit höherem Einkommen finden -, dass er andererseits eher in Institutionen zur Verfügung steht beziehungsweise Computerkenntnisse dort gefordert werden, in denen eine höhere Ausbildung vermittelt wird. Dort kommt man also einerseits mehr in Kontakt mit dem Medium, durchläuft aber auch andererseits eine Ausbildung, die eher zu Berufen prädestiniert, in denen wiederum diese Kenntnisse von Bedeutung sind. Differenziertere Aussagen über das Lesen am Bildschirm bezüglich Kriterien wie Alter oder Geschlecht können auf Grund des vorhandenen Datenmaterials an dieser Stelle nicht getroffen werden, da es hierfür einer Spezialstudie bedürfte.
Von Bedeutung ist an dieser Stelle auch eher, den tatsächlichen Umgang mit Texten am Bildschirm genauer zu untersuchen. Zunächst scheint die Tatsache, dass jeder zweite Computernutzer angibt am Bildschirm zu lesen, recht positiv zu bewerten zu sein. Differenzierter wird dieses Bild dann, wenn qualitatives Datenmaterial hinzugezogen wird. Bei der Gewinnung dieses Materials wurde weit mehr Spielraum bei der Beantwortung der Frage nach dem Lesen am Bildschirm zugelassen, als Ja/Nein-Fragen dies können. Das einfache ›Ja, ich lese am Bildschirm‹ wird hier sehr schnell mit einem ›aber‹ ergänzt, das auf Hindernisse und Schwierigkeiten im Umgang mit gewohnten Lesestrategien und dem neuen Medium schließen lässt.
In den narrativen Interviews der Studie der Stiftung Lesen werden die Nachteile des Lesens am Bildschirm viel stärker ausformuliert. Dabei werden zunächst eher physische Probleme bei der Handhabung des Trägermediums angesprochen und weniger solche Probleme, die im Umgang mit den Medienprodukten – also den Texten selbst – auftreten. Lesen am Bildschirm bedeutet für viele Computernutzer vor allem Umgewöhnung und Anstrengung. Das Sitzen vor dem Bildschirm ist auf Dauer unbequem, und auch die Augen ermüden schneller als bei herkömmlicher Lektüre. Dazu kommt, dass der Bildschirm für viele nicht die Qualitäten aufweist, die am Buch geschätzt werden. So erfolgt zum Beispiel das Blättern nicht mehr am Objekt direkt, sondern über Mittler wie zum Beispiel Maus oder Computertastatur. Anmerkungen oder Anstreichungen können auch nicht mehr im gewohnter Weise vorgenommen werden; und man ist in Bezug auf den Leseort sehr unflexibel, weil sich der Computer nicht kurz entschlossen mit in den Garten nehmen lässt.[36]
Ich würde eher ausdrucken, als am Bildschirm zu lesen. Das Flimmern des Bildschirmes stört mich doch immer stark. Vielleicht würde ich das mit wirklich flimmerfreien Bildschirmen anders machen. Aber ansonsten sind es so die selben Gründe, warum ich eine Zeitschrift auch lieber in Papierform mit mir hab. Die kann man transportieren, Sachen anstreichen, was rausreißen auch. Ja. Notizen machen und weiter geben. Das sind einfach Chancen, die mir der Bildschirmtext nicht bietet. (männlich, 30, Fallnummer 180)
Aber auch das als transportable Alternative zum feststehenden Computer propagierte E-Book erweist sich auf Dauer als eher unhandlich und wird als kalt empfunden. Es fehlt einfach das schöne haptische Gefühl, das Bücher für die meisten vermitteln. Kurz, der sinnliche Aspekt des Lesens, der über viele Jahrzehnte der Lesesozialisation – bewusst oder unbewusst – zu schätzen gelernt wurde, geht beim Lesen am Bildschirm verloren. Diese Nachteile werden übrigens von jüngeren Computernutzern nicht viel anders formuliert als von älteren Computernutzern, auch wenn sie, auf Grund ihrer veränderten Mediensozialisation, eher im Umgang mit den neuen Medien geübt sind. Allerdings lagen mir zum Leseverhalten am Bildschirm von Kindern unter vierzehn Jahren keine und von Jugendlichen bis neunzehn Jahren keine ausreichenden Zahlen vor, die tiefergehende Einblicke und Rückschlüsse erlauben würden. Diese Generation ist bereits seit Beginn ihrer Mediensozialisation an den Umgang mit Computer und Internet gewöhnt und hat dementsprechend andere Vorprägungen, im Gegensatz zu den heute um die 30-jährigen (oder den noch Älteren), die erst zu einem späteren Zeitpunkt ihrer Mediensozialisation damit in Kontakt kamen. Unter Umständen gestaltet sich die Wahrnehmung dieser Generation schon deutlich anders.
In einem E-Book lesen? Nein, finde ich irgendwie stillos. Klar, es ist im Endeffekt das gleiche. Mir würde einfach das Blättern fehlen. Ich finde es ungemütlich. (weiblich, 27, Fallnummer 69)
Nicht komplett abwegig, aber ich finde es unangenehm. Etwas in der Hand zu haben, das ist irgendwie besser. (männlich, 24, Fallnummer 62)
Ein Buch kann man in die Hand nehmen. Schöne Bücher, die haben auch einen Einband, und die haben eine Papierqualität, und die haben einfach einen Materialwert, den man fühlen kann mit den Fingern, und ich glaube, das ist was Wichtiges. (weiblich, 59, Fallnummer 22)
Als Alternative zum Lesen am Bildschirm wird immer wieder das Ausdrucken von digitalen Texten genannt. Nur jeder vierte Computernutzer liest ausschließlich am Bildschirm. Alle anderen drucken sich den jeweiligen Text zur eigentlichen, zumindest aber zur zusätzlichen Lektüre oder zur Archivierung noch einmal aus.[37] Ausschlaggebend für das Ausdrucken ist zumeist die Länge des Textes, häufig aber auch die Textart oder der Inhalt.
Also, so zehn Seiten kann man nicht so gut lesen. Da drucke ich mir das aus, das ist besser. (männlich, 24, Fallnummer 62)
Lesen am Bildschirm? Eher nein. Also, ich bin schneller an dem Punkt, dass ich ausdrucke und dann lese. Wobei viel von der, wenn man wirklich im Netz was sucht, dann verbringt man ja viel Zeit mit der Suche an und für sich. Und das ist dann alles eben auch Bildschirmlesen. Aber sobald ich dann einen Text gefunden habe, den ich dann brauche, druck' ich den aus. Und beschäftige mich mit dem in Papierform. (männlich, 30, Fallnummer 180)
Romane würde ich generell so nicht lesen, ein ganzes Skript auch nicht. Wenn man etwas Bestimmtes sucht, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man hin und her springt, um irgendwelche Informationen sucht, aber im Detail nicht. Und auch nicht, wenn es darum geht, es zu lernen. (männlich, 24, Fallnummer 62)
Lange Texte lassen sich offensichtlich nicht mit dem Medium Computerbildschirm vereinbaren. Man liest sie ungern am Bildschirm, weil die Augen nach einer Weile tränen und der Rücken schmerzt, für das Lesen literarischer Texte fehlt beim Computer der frei wählbare Leseort und das Haptische des Buches, und für die Arbeit mit Texten hätte der Leser lieber einen Stift in der Hand, um Anmerkungen vornehmen zu können. Geschätzt wird also die schnelle und effiziente Informationssuche über den Bildschirm, abgelehnt wird dagegen der Bildschirm für die intensive Lektüre.
Was für Texte ich am Bildschirm lese? Keine literarischen natürlich! Das sind dann irgendwie Anleitungen, wie man Software zu behandeln hat oder Kurzinformationen [...] für eine Reise oder ein Produkt, wo es reicht, das einmal zu überfliegen, dann weiß ich, okay, nein, das kommt für mich nicht in Frage, dann lohnt sich das nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, also das will ich gründlicher lesen, dann drucke ich es halt hinterher aus. (männlich 47, Fallnummer 44)
Am Bildschirm gelesen werden immer nur kleine Text- und Informationseinheiten. Diese können sich im Laufe einer Sitzung vor dem Bildschirm durchaus zu einem großen Gesamttext zusammenfügen, aufgenommen werden sie jedoch in relativ kleinen ›Portionen‹. Ganz deutlich liegen daher auch die Online-Ausgaben von Tageszeitungen oder Magazinen in der Gunst der Bildschirmleser vorne (siehe untere Grafik). Jeder dritte Computernutzer informiert sich speziell auf diesen Websites und insgesamt 40 Prozent aller Bildschirmleser nutzen das Internet generell als eine Informationsquelle. Zu den häufig genutzten Angeboten des Internets zählen aber auch Serviceangebote, wie bestimmte Auskunftsstellen oder E-Commerce-Anbieter, die zusätzliche Informationen über ihre Ware anbieten. Etwa jeder dritte Computernutzer informiert sich online über den nächsten Urlaub oder Neuerscheinungen. Und auch für die Wissenschaft scheint der schnelle und zeitlich unbegrenzte Zugang zum Internet einen großen Vorteil zu bieten. Jeder dritte Computernutzer greift auf Fachtexte oder Datenbanken zurück.
Lesen am Bildschirm – Textsortennutzung
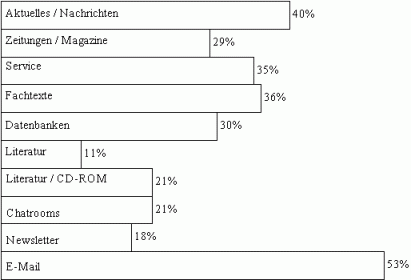
Die informative Funktion des Internets wird von den meisten Befragten offensichtlich gut angenommen. Aber auch der kommunikative Aspekt des Internets ist für einen großen Teil der Computer- und Internetnutzer von Bedeutung. Jeder Fünfte nutzt heute Angebote aus Newsletters, Newsgroups und von Mailinglisten oder kommuniziert in Chatrooms. Am meisten genannt wird das Lesen von E-Mails, nämlich von über der Hälfte aller Bildschirmleser.
Literarische Texte dagegen, obwohl durchaus in großer Anzahl im Internet vorhanden,[38] finden keinen allzu großen Zuspruch. Nur etwa jeder Zehnte gibt an, Netzliteratur oder Online-Literaturmagazine am Bildschirm zu lesen. Digitale literarische Texte auf Datenträgern, die nicht online genutzt werden müssen (wie etwa die CD-ROM), werden dagegen doppelt so häufig gelesen. Zu den bereits genannten physischen Faktoren kommt hier offensichtlich noch das Problem der Kosten. Texte, die online gelesen werden, sind nicht nur unhandlicher als gedruckte Texte, sondern werden auch als kostenintensiver wahrgenommen. Am Bildschirm wird das Lesen nach Minuten abgerechnet. Jedes Verweilen über einzelnen Passagen sowie wiederholende Lektüre wird als Kosten steigernd empfunden, auch wenn sich das bei einer Aufrechnung wahrscheinlich so nicht bestätigen würde, da die Online-Kosten inzwischen relativ niedrig anzusetzen sind.
Die bisher angesprochenen Hemmnisse beim Lesen am Bildschirm resultieren aus dem Medium selbst, weil es im Gegensatz zum Gedruckten als unsinnlich und unhandlich empfunden wird. Hinzu kommen aber auch noch Hemmnisse, die dem Leser durch die eigentlichen Medienprodukte entstehen. Wie gehen wir damit um, wenn uns Texte vorliegen, die anders funktionieren als Texte, die wir bisher kannten und mit denen wir umzugehen wussten? Ist es nicht wesentlich schwieriger, einen Text nur im Kopf zu konstruieren, anstatt ihn sich bildlich als Ganzes vor Augen zu führen und somit das Gedächtnis entlasten zu können? Wenn man Leser nach der Einschätzung ihres Umgangs mit den Medienprodukten befragt, würde man daher erwarten, dass Schwierigkeiten thematisiert werden, die diese Form des Lesens mit sich bringen kann. Die äußerst positive Selbsteinschätzung von Bildschirmlesern erstaunt daher sehr. Fragt man sie nach erfolgreicher Informationssuche, gutem Überblick und möglichem Stress beim Lesen am Bildschirm, zeigt sich ein durchgehend positives Bild. Dabei gibt es nur geringe Unterschiede bezüglich des Alters oder anderer Merkmale. Computernutzer haben das Gefühl, einen guten Überblick zu erhalten und benötigte Informationen leicht zu finden, sie fühlen sich nicht gestresst, vergessen aber durchaus manchmal die Zeit. Eine mögliche Erklärung für die Diskrepanz zwischen potentiellen Schwierigkeiten und Selbstwahrnehmung ist sicher auch in der Tatsache zu suchen, dass Bildschirmleser eine Teilgruppe der Computernutzer sind, die wiederum häufig über eine recht hohe Medien- und Lesekompetenz verfügen. Wer also einen Computer nutzt, hat sich häufig auch schon in anderen Medien Rezeptionsstrategien angeeignet, die sich hier auf verschiedenste Weise wieder verwenden lassen. Dazu zählen unter anderem Lesestrategien wie das Querlesen oder das selektive Lesen, aber auch die über das Fernsehen eingeübte Strategie des Zappens.
Lesen am Bildschirm – Selbsteinschätzung
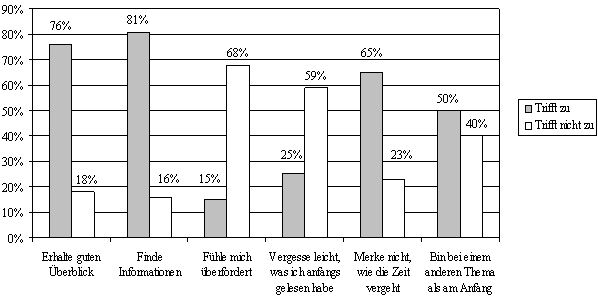
Im Schnitt meinen drei Viertel der Befragten, dass sie einen guten Überblick beim Lesen am Bildschirm haben und dass sie leicht die Informationen finden, die sie tatsächlich gesucht haben (siehe obere Grafik). Dabei spielt das Alter für diese Einschätzung nur eine geringe Rolle. Die Jüngeren sind jedoch sicher durch ihre bereits veränderte Mediensozialisation eher auf Bildschirminteraktion eingestellt. Dabei fühlen sich die älteren Computernutzer auf keinen Fall vom neuen Medium stärker überfordert als junge Nutzer – nur etwa ein Drittel der älteren Computernutzer setzt das ›Herumspringen‹ unter Stress. Eben so viele Computernutzer geben an, nicht zu merken, wie die Zeit vergeht – wahrscheinlich liegt hierin auch der Grund des stressfreien Surfens.
Sehr geringe Unterschiede kann man bei der Frage ausmachen, ob man im Laufe einer Internetsitzung am Ende bei einem anderen Thema angekommen ist als dem, mit dem man angefangen hat. Jeder Zweite bejaht diese Frage und fast ebenso viele verneinen, bei einem anderen Thema zu landen. Auffällig ist dabei nur, dass vor allem ältere Menschen angeben, nicht vom Ausgangsthema abzukommen, während Jüngere öfter von ihrem Ausgangsthema abschweifen. Je nach Betrachtungsweise kann man hier zu positiven oder negativen Ergebnissen bezüglich der Computerkompetenzen älterer Menschen kommen. So könnte man den Befund einerseits so interpretieren, dass ältere Menschen sich ängstlich und selbst beschränkend im Internet fortbewegen, andererseits könnte man aber genauso gut annehmen, dass sie sich nicht vom Medium beherrschen lassen und selbstbestimmt ihre Informationssuche verfolgen.
Kombiniert man hier die aus der qualitativen Studie gewonnenen Ergebnisse mit Aussagen der narrativen Interviews, so erhält man, ähnlich wie bei den Ergebnissen zu den physischen Hindernissen, ein weitaus differenzierteres Bild. Die erwarteten Probleme – Verwirrung, Desorientierung oder Stress – kommen hier durchaus immer wieder zur Sprache – auch wenn sie weniger häufig genannt werden als physische Lesehindernisse. In den narrativen Interviews werden der fehlende Überblick, die Orientierungslosigkeit und die fehlende Übung im Umgang mit neuen Rezeptionsstrategien thematisiert.
Weil, bei Bildschirmen, da ist man so was vom Zufall abhängig, was kommt als nächstes und [...] man hat keinen Überblick. (weiblich, 59, Fallnummer 22)
Das ist schon recht schwer, gezielt etwas zu finden. Das war schon oft, dass ich Stunden davor gesessen habe bis ich die entsprechende Seite gefunden habe. Wenn man sich nicht genau aufgeschrieben hat, wo man schon war, findet man die Seite garantiert nicht wieder. (männlich, 24, Fallnummer 76)
Ach ist das mühsam und dann hab ich dauernd, bis ich das hingekriegt habe. Dauernd eine Frage reingegeben, dann hat einer geantwortet und dann konnte man sich über den Brief wieder raustun, dann musste man den wieder schließen, weil man nicht beide gleichzeitig aufmachen kann, dann hab ich den schon wieder vergessen, was der gefragt hat und worauf der geantwortet. Ein bisschen mühsam vielleicht, aber [...] unheimlich viel ist da drin, dachte ich gar nicht. (weiblich, 51, Fallnummer 36)
Dagegen wird der Mehrwert, den man aus dem Lesen digitaler Hypertexte ziehen kann, nur von Wenigen thematisiert. Man ist eher erstaunt, dass man trotz der vielen Anstrengungen doch etwas Positives an dem Medium finden kann. Wenn ein Mehrwert angesprochen wird, dann der, dass das Internet schnellen Zugang zu einem großen, konzentrierten und ständig verfügbaren Informationsangebot bietet, das prinzipiell, wenn man die richtigen Strategien beherrscht, auch das Gesuchte bereithält. Wobei hiermit natürlich nichts über die Korrektheit und Glaubhaftigkeit der Informationen gesagt ist.
Das Netz bietet mir die Möglichkeit, so zu sagen, aus einer imaginären riesigen Bibliothek sofort das richtige Buch zu finden. Wenn man mit einer guten Suchmaschine umgehen kann, findet man doch sehr schnell die Seiten, die man braucht. Wo die Information enthalten ist, die man gerade haben will. Und da ist das Netz jeder Bibliothek weit überlegen, denke ich. (männlich, 30, Fallnummer 180)
Man sucht und findet. (männlich, 28, Fallnummer 71)
Trotz aller positiven Selbsteinschätzung zieht sich die Vorstellung von einem Kampf oder einer Auseinandersetzung mit dem Medium durch alle Aussagen hindurch. Man will das Medium und das, was es einem zu bieten hat, beherrschen und nutzen können, aber man wird in diesem Vorhaben ab und zu behindert.
Es ist eine Hassliebe. Ich hasse die Maschine natürlich, wenn sie nicht das tut, was ich will [...] aber ich kann es auch nicht lassen. (männlich, 47, Fallnummer 44)
Ja. Ja klar. Natürlich habe ich Frustrationserlebnisse. [ Interviewer: Und was machen Sie dann?] Fluchen. Und noch mal probieren. (männlich, 47, Fallnummer 44)
Die Möglichkeiten, die das Internet sowie Hypertexte dem Leser in Form von Informationsfülle und Vernetztheit bieten, werden also von den Lesern durchaus als Mehrwert erkannt. Der behauptete Mehrwert durch einen Zugewinn an Freiheit auf Seiten des Lesers wird vom Leser jedoch nur begrenzt als solcher erkannt, weil er diese Entscheidungsfreiheit häufig eher als Entscheidungszwang oder als verwirrend empfindet. Der Wille, das Angebot auch in seiner ganzen Breite erfolgreich und effizient für sich nutzen zu können, fördert aber offensichtlich auch die Bereitschaft, sich mit den Hemmnissen auseinanderzusetzen.
Die neuen Medien haben ihren Platz in unserer Gesellschaft gefunden. Auch ihre Produkte sind in ihrem Vormarsch nicht mehr aufzuhalten. Die oben zitierten Äußerungen der Mediennutzer zeigen, dass man sich langsam tastend an ›das Neue‹ heranwagt, dass es aber nicht so einfach ist, die im Umgang mit den ›alten‹ Medien eingeübten Strategien zu modifizieren oder abzulegen. Dies ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet oder stattfinden kann; dass er aber stattfinden muss, ist unstrittig.
In Bezug auf den Hypertext gilt es, die Schwierigkeiten, die seine Rezeption mit sich bringt, zu erkennen und Konsequenzen daraus zu ziehen, wenn man ihn als ein dem gedruckten Text ebenbürtiges Medium der Speicherung und Vermittlung von Wissen etablieren will. Natürlich hat der Hypertext heute schon Vorteile, die die Printmedien so nicht bieten. Hervorzuheben sind hier besonders die Möglichkeiten der Vernetzung von Informationen und die Möglichkeit der Integration verschiedenartiger Medienprodukte auf einer Oberfläche. Andererseits ist der Hypertext ein in vielen Punkten offensichtlich noch nicht ausgereiftes Medium. Auch das Buch hat, vor allem in Bezug auf die Wissensvermittlung, eine lange Entwicklung durchlaufen. Diese Zeit hat der Hypertext noch nicht gehabt und dementsprechend groß ist die Differenz zwischen den an ihn gerichteten Erwartungen und den tatsächlichen Realisierungen.
Auch wenn ein großer Teil der Befragten unserer Studie angibt, sich nicht von Computer oder Internet überfordert zu fühlen, so ist trotzdem zu beachten, dass dies zum einen durch die Aussagen der narrativen Interviews differenziert worden ist, und dass es zum anderen trotzdem eine, wenn auch kleinere, Gruppe von Befragten gibt, die sich als weitaus weniger sicher im Umgang mit diesen Medien und ihren Produkten einschätzt. Hinzu kommt, dass die Gruppe der Computernutzer wiederum nur einen Teil der insgesamt Befragten ausmacht. Über die Hälfte der Deutschen nutzt (noch) keinen Computer und viele tun dies nicht unbedingt nur deshalb, weil sie keinen Zugang dazu haben oder zu den Medienpessimisten gehören, die deren Nutzung aus Prinzip ablehnen. Für viele liegt, auch wenn sie prinzipiell eine gewisse Medienkompetenz besitzen, die Hemmschwelle sicher noch zu hoch, um sich mit dem Computer oder dem Internet auseinandersetzen zu können oder zu wollen.
Die Gestaltung von Internetseiten muss also in Zukunft sicher deutlich mehr den Bedürfnissen und dem Verhalten der Nutzer angepasst werden. Bisher dominiert häufig noch der Spaß an technischen Spielereien über die Umsetzung von Erkenntnissen über das Lese- und Nutzungsverhalten. In der zunehmenden Datenflut zählt jedoch nicht mehr alleine das Erregen der Aufmerksamkeit durch möglichst bunte und technifizierte Gestaltung, es wird immer wichtiger, dem Nutzer klare Informationen und Strukturen zu vermitteln, um sein Interesse zu wecken und zu halten. Aufmerksamkeit kann sich in Zukunft nur noch der bewahren, der die Nutzer und ihr Verhalten kennt. Diese Schlussfolgerung ist eigentlich ein ›alter Hut‹ – muss aber wohl im neuen Medium noch einmal von Neuem erlernt werden. Schließlich geht es weniger darum, tatsächlich Neues zu lesen, sondern um das neue Lesen.[39] Dabei ist es nicht nur die Aufgabe der Bildungsinstitutionen, die zukünftigen Nutzer auf den richtigen Umgang mit den Medien und ihren Produkten vorzubereiten. Es muss auch die Aufgabe der ›Macher‹ sein, auf die Bedürfnisse der Nutzer einzugehen. Die neue Form des Lesens muss durch die Anpassung der Medienprodukte an vorhandene Lesestrategien unterstützt werden, wenn man im neuen Medium tatsächlich gelesen werden will.[40]
Gesine Boesken
Gesine Boesken
Ravensburgerstr. 82
50739 Köln
gesine.boesken@t-online.de