
Abstract
A look from the viewpoint of the linguistic theory of text, as in this article, may result in reconsideration of some key-ideas common to many non-linguistic publications about hypertext. Since hypertext is frequently thought of as a primarily textual phenomenon (single text or system of texts), the authors of this article search for its linguistic definition based upon the knowledge about text production and reception that was gathered by many researchers in text linguistics during past four decades. A genuine concept of hypertext developed by computer science in 1960s-1980s serves in this case as a framework for the discussion. The article shows that verbal components of hypertext have to satisfy the general textuality criteria to become texts. Those criteria, however, clash with the notion of hypertext as a kind of non-constrained text and make the philosophical vision of an unlimited, universal hypertext unrealistic.
Der Hypertext wurde vor allem dank der Entwicklung des World Wide Web (WWW) zu einem der wichtigsten Verknüpfungspunkte von Philologie und Computertechnik. Die Rolle des Hypertextes geht dabei weit über seine informationstechnischen Eigenschaften hinaus und gibt neue Themen und Inspirationen sowohl für Geisteswissenschaftler als auch für Künstler und Literaten, von denen viele sogar eine revolutionäre Auswirkung des Hypertextes auf das menschliche Geistesleben prophezeien. Die wohl berechtigte Faszination eines Autors, der noch vor einigen wenigen Jahren nur eine Schreibmaschine oder gar einen Bleistift bei seiner täglichen Arbeit benutzte, veranlasst immer neue Versuche, die Bedeutung der Rechentechnik (samt den dort gängigen Stichwörtern) im Kontext der eigenen wissenschaftlichen Disziplin umzudenken.
Wahrscheinlich dank seinem zweiten Bestandteil – ›Text‹ – wird das primär technische Fachwort ›Hypertext‹ heute durch immer weitere Bereiche der Geisteswissenschaften übernommen und (oft rücksichtslos) an ihre Untersuchungsgegenstände angepasst. Die Textlinguistik, die sonst als ihre Aufgabe ansieht, »die allgemeinen Bedingungen und Regeln der Textkonstruktion, die den konkreten Texten zugrunde liegen, systematisch zu beschreiben und ihre Bedeutung für die Textrezeption zu erklären«,[1] ist dabei eine der wenigen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die das Thema ›Hypertext‹ offenbar noch nicht berührte.
Die Tatsache, dass jegliche mehr oder weniger seriöse textlinguistische Analyse des Hypertextes immer noch in der bereits umfangreichen Hypertext-Bibliographie vermisst wird, lässt uns annehmen, dass die Textlinguisten den Hypertext als einen Forschungsgegenstand entweder noch nicht entdeckt haben oder keine Möglichkeit sehen, ihn als solchen zu betrachten. Da eine solche Analyse des Hypertextes sehr schnell die Grenzen eines Artikels sprengen würde, ist sie daher nicht das Ziel der folgenden Ausführung. Auf den nächsten Seiten wollen wir allerdings die grundsätzliche Frage stellen, ob Hypertext ein Text ist und als solcher ein Objekt philologischer, vor allem textlinguistischer, Forschung sein kann.
Wir möchten dabei das Verhältnis zwischen den beiden Begriffen ›Text‹ und ›Hypertext‹ in unserem Aufsatz auf zweifache Weise angehen. Einmal, indem wir zu den Ursprüngen zurückkehren und uns an das informationstechnische Originalkonzept des Hypertextes erinnern. Danach versuchen wir diese Frage in den Kontext der Textlinguistik zu stellen und aus deren Gesichtspunkt die Relevanz der dem Hypertext zugeschriebenen und der tatsächlichen Eigenschaften zu diskutieren, die dieses Verhältnis kennzeichnen sollen.
Bevor wir uns auf die Suche nach textuellen Eigenschaften des Hypertextes machen, sollte die grundsätzliche Frage nach seinem Wesen beantwortet werden. Der allgemein anerkannte Autor des Ausdrucks ›Hypertext‹ ist Ted Nelson, ein Philosoph der Informatik, der ihn anscheinend schon 1965 in seinem Beitrag A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminat auf der 20. Nationalen Konferenz der Association for Computing Machinary zum ersten Mal öffentlich benutzt hatte und in späteren Publikationen seine Auffassung von diesem Begriff weiter präzisierte.[2] Das Wort wurde bald populär unter Informatikern, die an der Entwicklung von solchen technischen Systemen arbeiteten, die Daten als für den Menschen verständliche Informationen, netzartig und geordnet durch Querverweise, darstellen sollten. Die Auffassung davon ist sowohl durch die Vorstellung von einem System der sprachlichen Texte (der eigentliche ›Hypertext‹), als auch durch die Idee geprägt, dass die im Hypertext verbundenen Dokumente ›multimedial‹ sein können (›Hypermedia‹).[3]
Allerdings lassen uns die Charakteristiken des modernen Computers Hypertext und Hypermedia in ein gemeinsames Phänomen ›Hypertext‹ zusammenführen. Ein Computer vereinigt heute alle der Menschheit bekannten Medien – Schrift, Bild, Film, Hörfunk, Fernsehen et cetera – und bietet ein einziges Medium für praktisch alle denkbaren Zeichensysteme, so dass ein moderner Hypertext eine Reihe von schriftlichen, auditiven, visuell-dynamischen, fotografischen und grafischen Dokumenten verbinden kann.[4] Eine solche Vorstellung von Hypertext wäre auch durch das umfangreichere Konzept eines Textes begründet, wie es die Semiotik versteht, das heißt als eine Sequenz von Zeichen, die zu unterschiedlichen Zeichensystemen gehören können.
Der grafischen Benutzeroberfläche (englisch: Graphical User Interface = GUI), welche heute die wichtigste Schnittstelle für den Kontakt zwischen Mensch und Computer ist, lag die Überlegung von der Notwendigkeit zugrunde, den Prozess der Ordnung von Zeichen (›Symbol Structuring‹) zu simulieren, was der natürlichen mentalen Tätigkeit des Menschen am besten entsprechen würde. In der Dokumentation zum ersten Projekt heißt es:
We are generally used to thinking of our symbol structures as a pattern of marks on a sheet of paper. When we want a different symbol-structure view, we think of shifting our point of attention on the sheet, or moving a new sheet into position. But another kind of view might be obtained by extracting and ordering all statements in the local text that bear upon consideration of the argument – or by replacing all occurrences of specified esoteric words by one's own definitions. This sort of »view generation« becomes quite feasible with a computer-controlled display system, and represents a very significant capability to build upon.[5]
Da der Computer mit digital kodierten Daten operiert, die vom Menschen nicht direkt wahrgenommen und interpretiert werden können, bedürfen sowohl die Dateneingabe als auch die Ausgabe der Informationen eines solchen Kommunikationskanals, über den die Umwandlung zwischen den dem Menschen verständlichen Zeichen und dem Binärcode in beiden Richtungen möglich wird.[6] Das Prinzip, nach dem die Maus, die Tastatur sowie das Display eines Rechners funktionieren, beruht auf der Konvention, nach der eine solche Umwandlung verläuft. Die Tastatur ist so konstruiert, dass der User den Eindruck hat, als ob er direkt die gewöhnlichen Buchstaben aus seiner Sprache auf den Bildschirm schreibt. Wenn man die Maus auf dem Tisch bewegt und auf die Tasten drückt, sieht man auf dem Bildschirm einen Zeiger (Cursor) sowie grafische Objekte, die auf seine Bewegungen reagieren. Beides, sowohl das Tippen als auch das Anklicken mit der Maus und Herumschieben der Objekte auf dem Bildschirm ist eine Illusion, die dem Menschen helfen soll, die Maschine auf die für ihn übliche Weise zu steuern, das heißt durch Manipulation von Gegenständen (Schalter, Griffe et cetera) und Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Piktogramme et cetera). Die Buchstaben und Bilder auf dem Bildschirm dienen dabei nur zur Orientierung des Nutzers in dem, was der Rechner auf seinen Befehl hin tut. Auf einen Tastendruck wird keinesfalls ein Buchstabe auf das Display des Computers geschickt (wie es bei einer Schreibmaschine der Fall wäre), sondern ein elektrischer Impuls, der dem Prozessor etwas signalisieren soll, was nach komplexer Verarbeitung und auf Umwegen, die durch Hardware und Betriebsystem führen, auf dem Bildschirm als ein Buchstabe erscheint und nichts anderes ist, als eine Antwort des Rechners, dass er die Eingabe beziehungsweise den Befehl des Users richtig ›verstanden‹ hat. Wenn viele Signale per Tastatur in den Computer geschickt werden, und wenn sowohl die Hardware, als auch die Software richtig funktionieren, kann ein Text auf dem Bildschirm entstehen. Falls aber etwas schief geht, sieht der frustrierte Computerliebhaber etwas, was er gerne als ›Müll‹ bezeichnet. Für den Rechner ist es jedoch kein Müll, sondern genau das, was der Mensch eben eingegeben hat – nur das Bild ist falsch.
Das technische Prinzip, welches der Funktion der Eingabegeräte des Computers zugrunde liegt, unterscheidet sich also kaum von der Programmierung einer Waschmaschine oder der Umschaltung der Kanäle in einem Fernseher. Alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist – Fenster, Knöpfe, Bilder, Animationen, Videos, sowie die herumlaufenden Maus- und Tastatur-Cursor, ist virtuell und ist nur die Ausgabe der binär kodierten Daten, die in bestimmte visuelle Information für den Menschen umgewandelt werden. Diese Information kann mit Hilfe eines anderen Ausgabegerätes – zum Beispiel eines Druckers – auf Papier oder ein ähnliches physisches Medium gebracht werden. Eine Übertragung der Information von einem Medium zum anderen (vom Computer zum Papier), die dabei erfolgt, ist mit manueller Überschreibung eines Textes von einem Blatt Papier auf ein anderes vergleichbar.
Die Realisierung des Hypertext-Konzeptes wurde erst mit der Entstehung einer interaktiven Benutzeroberfläche möglich, die der Nutzer per Tastatur und mit Hilfe eines speziellen Gerätes – der Computer-Maus – kontrolliert und die Befehle dem Betriebssystem des Rechners erteilt. Die Maus wurde von Douglas C. Engelbart, dem Entwickler des GUI, in den 1960er Jahren am Stanford Research Institute erfunden und sollte die Hauptrolle im Interface zu einem Online-System namens NLS spielen, an dessen Prototyp Engelbart damals arbeitete. NLS sollte Navigation und Verfassen der in einem Hypertext verknüpften Dokumente sowie das Verschicken von E-Mails ermöglichen. In der Beschreibung des Systems lassen sich schon im Jahr 1975 einige Züge des heutigen Webs erkennen:
The present NLS information space is hierarchically organized. A user has a directory or directories within which there are files. A file can contain notes on many subjects stored under various headings, his mail, or single documents.
Files in turn are hierarchically organized as a tree of information nodes containing text, graphics, or both. Files can contain cross citations to specific points within other files or the same file, thus creating networks. NLS has appropriate commands for moving within and between files and for obtaining a display of the path over which one has traveld, and commands for backtracking along this path. [...].[7]
Übrigens war die Idee der Automatisierung der Querverweise zwischen Dokumenten viel früher ausgesprochen worden, worauf sich auch D. Engelbart in einem Bericht an das Air Force Office of Scientific Research bezog, indem er das dem NLS zugrunde liegende Konzept – »Augmenting Human Intellect« (»Verstärkung der menschlichen Intelligenz«) – erklärte.[8] 1945 verfasste Vannevar Bush, der Direktor des US Office for Scientific Research and Development, einen Artikel für die amerikanische Zeitschrift Atlantic Monthly, wo er über Memex, eine foto-elektrisch-mechanische Anlage schrieb, die Querverweise zwischen Dokumenten auf Mikrofilmen nicht nur herstellen, sondern auch diesen folgen konnte. Bush konzipierte Memex (memory extension) als »Erweiterung des menschlichen Gedächtnisses durch mechanische Mittel«:
Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library. It needs a name, and, to coin one at random, »memex« will do. A memex is a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory.[9]
Es lässt sich also aus dem oben Gesagten folgern, dass der Hypertext seinem Konzept nach nichts anderes als ein Interface für die Interaktion des Nutzers mit dem Betriebssystem und dem Rechner ist, das den Zu- und Umgang mit den dort vorhandenen Daten zu erleichtern hat. Dafür spricht auch die Konzeption der Oberfläche von den meisten zeitgenössischen Betriebssystemen, die sich wie ein Web-Browser benimmt, so dass kein Unterschied zwischen dem lokalen Rechner, dem Lokalnetz und dem Internet gemacht wird.
In vielen Aspekten gleicht der Hypertext einer Datenbank (und wird auch meistens als solche verstanden[10]), wo die Daten meistens bereits als fertige Informationen (WWW-Seiten) vorliegen und eine Struktur von Knoten (englisch: nodes) bilden.[11] Die Suche in einer solchen Datenbank erfolgt statt auf Anfrage durch das ›Surfen‹ über Kanten (englisch: hyperlinks) von einem Knoten zum anderen. Laut der aktuellen Definition durch das W3-Konsortium (W3C) sind Hypertext und Hypermedia »keine Produkte, sondern Konzepte«, die im großen Projekt namens World Wide Web benutzt werden.[12] Das Web ist somit die größte verteilte Datenbank der Welt, die auf Hypertext basiert.
Außer der Feststellung, dass Hypertext primär ein Konzept für die Gestaltung von Benutzeroberflächen und Datenbanksystemen[13] ist, lässt sich noch eine Konsequenz aus der obigen Ausführung ziehen, nämlich, dass Virtualität wohl das wichtigste Merkmal der Objekte auf einem Computerbildschirm ist. Unter Umständen können die Zeichen, die von solchen virtuellen Objekten getragen werden, einen Text bilden. Die Prinzipien, die einer solchen Vertextung zugrunde liegen, werden, wie bereits angedeutet, seit Jahrzehnten von der Textlinguistik anhand von schriftlichen und mündlichen Texten in anderen Medien erforscht und systematisch beschrieben. Im Computerzeitalter hat der Mensch neue, zuvor unbekannte Mittel für einfaches und schnelles Textschreiben und Zeichenmanipulation bekommen, was ohne Zweifel den Prozess der Kommunikation weitgehend beeinflusst.[14] Dennoch sind die Grundsätze der Produktion und Rezeption von Texten, wie sie von Linguisten anhand der traditionellen Medien belegt wurden, universal gültig und zumindest dort, wo ein erfolgreicher Informationsaustausch zwischen menschlichen Kommunikanten erwartet wird, ist der einheitliche Bauplan eines Textes ein genauso wichtiger Teil der Konvention über den gemeinsamen Code wie die dort benutzten Zeichen. Sogar in den Programmiersprachen, deren primäre Aufgabe Kommunikation zwischen Mensch und Computer ist, gibt es stilistische Normen, die das Lesen des Programm-Codes für Programmierer erleichtern sollen.
Auch im Fall von Hypertext wird die Freiheit der Aneinanderreihung von Zeichen und Sätzen durch die von Textlinguisten erkannten (eigentlich biologischen im weiten Sinne dieses Wortes[15]) Eigenschaften des Menschen beschränkt. Es finden sich allerdings viele begeisterte Theoretiker, die von Hypertext als von einer Ausnahme sprechen wollen. So beispielsweise betrachtet man Hypertext in den im Internet ansässigen Literaturkreisen zwar als »eine Textform, in der Texte durch Hyperlinks verbunden sind« (Hervorhebung vom Verfasser),[16] jedoch werden einem solchen Text jegliche Textmerkmale verweigert.[17] Die heute leider populär gewordene Spekulation über einen Text als ›Hypertext‹ mit solchen ungewöhnlichen Eigenschaften wie Nicht-Linearität, Kohärenz- und Delimitationsmangel et cetera[18] wäre nur dann berechtigt, wenn eine nüchterne Antwort auf die Frage gegeben wird: Was sonst macht den Hypertext zu einem Text?
Hinsichtlich der Frage, was unter ›Text‹ zu verstehen ist, herrscht in der linguistischen Textwissenschaft bei weitem keine Übereinstimmung. Man kann aber feststellen, dass in Definitionen, in denen unter anderem Prinzipien der Strukturierung von Texten berücksichtigt werden, auf das Merkmal ›lineare Organisation‹ hingewiesen wird. Der Text wird dabei aufgefasst – in Anlehnung an die Semiotik – als eine Aufeinanderfolge von (sprachlichen) Zeichen,[19] sprachlichen Signalen,[20] sprachlichen Einheiten[21] oder – entsprechend dem strukturalen Ebenen-Modell,[22] wo der Text oberhalb der Satzebene platziert wird – als ein Nacheinander von Sätzen. Betont wird, dass diese lineare Aufeinanderfolge »einem Kompositionsplan gemäß selektiert«[23] und nach bestimmten Regeln oder Prinzipien geordnet werden muss.[24] Für die Gesamtheit aller Eigenschaften, die eine Aufeinanderfolge von sprachlichen Einheiten zum Text macht, führen Robert-A. de Beaugrande und Wolfgang Dressler den Begriff ›Textualität‹ ein. Sie definieren ›Text‹ als eine kommunikative Okkurrenz (englisch: occurrence), die sieben Kriterien der Textualität (Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität, Intertextualität) zu erfüllen hat.[25]
Wie Heinz Vater[26] zeigte, führt die Nicht-Erfüllung eines der von Beaugrande/Dressler postulierten Kriterien keineswegs automatisch zu einem nicht-kommunikativen Text (= zu einem Nicht-Text); zudem kann die gleiche Satzfolge von einem Rezipienten als Text akzeptiert werden, von einem anderen nicht. Dass nicht jede Folge sprachlicher Ausdrücke (nicht einmal jede Satzfolge) einen Text darstellt, möchten wir mit dem von Manfred Bierwisch verfassten und schon fast klassisch gewordenen Beispiel illustrieren:
Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreißt. Unsere Sängerin heißt Josephine. Gesang ist ein Wort mit fünf Buchstaben, Sängerinnen machen viele Worte.[27]
Die Sätze in diesem Beispiel sind grammatisch korrekt, und es lassen sich auch bestimmte satzübergreifende Relationen (Kohäsionsbeziehungen) erkennen: ›Gesang‹ – ›Sängerin‹, ›Wort‹ – ›Worte‹. Es ist jedoch kein echter Text, weil ein innerer Textzusammenhang und eine Sinnkontinuität fehlen, welche normalerweise die Sätze im Text miteinander verbinden sollen. Solche Satzsequenzen werden in der Linguistik häufig Pseudotexte genannt. Zu Pseudotexten gehören, so Wolfgang U. Dressler,[28] beispielsweise Wörterbücher, Konversationslexika und Zitatensammlungen, sowie asemantische Aneinanderreihungen beziehungsloser Wörter (Nonsens-Wörter), die zufällig durch technische Mittel hergestellt werden.
Man kann sich auch ein linear gedrucktes Nacheinander von relativ abgeschlossenen Satzsequenzen (Teileinheiten des Textes) vorstellen, zwischen denen sich kein inhaltlicher Zusammenhang erkennen lässt. Es müssen nicht unbedingt die (Ab-)Sätze sein, die verschiedenen Texten entnommen und absichtlich zu einem Pseudotext kombiniert wurden. Derart sinnlos können dem Leser zum Beispiel Anmerkungen am Ende eines Artikels oder Buches erscheinen, wenn er diese einfach nacheinander liest:
4 Es wäre nützlich gewesen, wenn Kant bei der Untersuchung der Beschränkungen des menschlichen Geistes seine eigenen Beschränkungen näher untersucht hätte – »seine« nicht im persönlichen Sinn, sondern »seine« als Teil einer Nation, einer Klasse, einer Tradition, einer Zivilisation und dergleichen. Aber es war kein Zeitalter vergleichender Studien, um Punkt für Punkt eine Zivilisation an der anderen zu messen.
5 Dies ist natürlich der Grund dafür, daß im Journalismus wie in der Forschung die Quellen anzugeben sind: der Leser hat das Recht, die Glaubwürdigkeit einzuschätzen.
6 Toynbee verwendet solche Zeichnungen, aber ich versuche nicht, mich hinter ihm zu verstecken. Mein Grund ist, wie gesagt, eine zu starke Identifikation mit den Ländern zu vermeiden.[29]
Für die Sinnkontinuität innerhalb des Wissens und für inhaltliche Zusammenhänge der Ausdrücke innerhalb eines Textes verwendet man in der Textlinguistik den Terminus Kohärenz:
Kohärenz in einem Text baut auf der Sinnkontinuität der zugrundeliegenden Textwelt auf. Sinn ist die im Textzusammenhang aktualisierte tatsächliche Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks. Die Textwelt ist Gesamtheit der einem Text zugrundeliegenden Sinnbezeichnungen; sie muß mit der realen Welt nicht unbedingt übereinstimmen: Es handelt sich um die vom Sprecher, von seinem Wissen und seinen Intentionen zugrundegelegte Textwelt.
Die Textwelt setzt sich aus Konzepten und Relationen zwischen diesen Konzepten zusammen. Konzepte sind in der Psychologie beziehungsweise Kognitionswissenschaft angenommene Einheiten unseres Wissens, die sich aufgrund von Wahrnehmung und Erfahrung dort gebildet haben – und die nicht notwendig ein getreues Abbild der realen Welt ergeben. Besteht eine Diskrepanz zwischen der in der Textwelt ausgedrückten Konzept-Konstellation und unserem Wissen, das heißt der Art, wie die betreffenden Konzepte in unserem Bewußtsein verbunden sind, dann können wir keine Sinnkontinuität herstellen; der betreffende Text ist für uns sinnlos.[30]
Nach Heinz Vater stellt die Kohärenz offenbar das dominierende Textualitätskriterium dar, das dazu verhilft, Satzfolgen, die Texte sind, von solchen, die nicht Texte sind, zu unterscheiden, und zwar ohne bestimmenden Blick auf ihre grammatische (morphologische, syntaktische) Korrektheit.[31]
Die Gefahr der Kohärenzstörung wird größer bei der Textverarbeitung am Computer, wenn Textteile frei ihre Plätze austauschen, einzelne Wörter und Sätze verschoben oder gelöscht werden. Das oben angeführte Beispiel der Anmerkungen aus einem wissenschaftlichen Artikel modelliert auch die Situation, in der der Leser den Verweisen auf einen anderen Text beziehungsweise Textteil folgt, ohne die Möglichkeit zu haben, später zu der selben Stelle zurückzukehren, an der er das Lesen des Textes unterbrochen hat. Einen Extremfall bieten in dieser Hinsicht hypertext-basierte Textsysteme. Ein unerfahrener Leser eines in ein Hypertext-System integrierten Textes, oder derjenige, der beim Lesen auf einen interessanten Hypertext-Anker trifft, wird die Seite auf der Stelle verlassen, um den abzweigenden Knoten zu lesen. Falls dieses nächste Dokument noch Verweise auf andere Dokumente enthält, die dem Leser interessant erscheinen, wird er immer neue Knoten nacheinander öffnen, so dass kein Text dabei bis zum Ende gelesen wird, und die Aufeinanderfolge von gelesenen Abschnitten verschiedener Seiten wird höchstwahrscheinlich nicht kohärent und einem Pseudotext ähnlich sein. Unter der URL <www-public.rz.uni-duesseldorf.de/~karlowsk/einzug.html> (02.07.2001) zum Beispiel lesen wir eine Erzählung mit dem Titel Spielzeugland. Der erste Text beginnt in der Datei <./einzug.html>. (Die Anker sind kursiv gesetzt.):
So stand ich ihm gegenüber. Nackt und kalt, denn ich fühlte mich zu dünn angezogen an diesem Tag. Der leichte Wind, der durch sein Zimmer strich, zerrte an meinem Hemd; ich fröstelte. Mächtig thronte [...].
An dieser Stelle verlassen wir die Seite, denn wir sind einem Anker begegnet, um die andere Seite <./zepter.html> zu lesen:
Hier sitz' ich wie der König auf dem Throne! Den Zepter halt ich hier, es fehlt nur noch die Krone. (Johann Wolfgang von Goethe, Faust [...].)
Jetzt folgen wir der Kante, die uns vom Anker ›Faust‹ auf die Seiten des Projektes Gutenberg führt. Von dort gibt es schon kein Zurück zu unserer ursprünglichen Lektüre, und wir sind gezwungen immer weitere Seiten zu öffnen, die gar nicht relevant sind, für das, was wir anfangs gelesen haben. Dieses Benehmen, das den Theoretikern des Hypertextes normal und zukunftsversprechend erscheint (das heißt wenn man die Texte nicht liest, sondern in ihnen »navigiert«,[32]) ist alles andere, als ein normaler kognitiver Prozess, bei welchem die Information gezielt wahrgenommen wird. Bezugnehmend auf eine solche ziemlich spezifische Handhabung spricht man oft über die Nicht-Linearität des Hypertextes, auch wenn man ein Hypertext-System als einen einzigen (kommunikativen) Text betrachten will.
Aus der Sicht der Textlinguistik ist in Bezug auf die lineare Organisation eines Textes zwischen Linearisierung und Linearität zu unterscheiden – je nach dem, ob der Text als Prozess oder als Resultat, das heißt Produkt eines Kommunikationsvorgangs betrachtet wird. (In manchen linguistischen Arbeiten ist es allerdings nicht ersichtlich, ob der Autor jeweils mit einem statischen oder prozessualen Textbegriff operiert.) Betrachtet man den Text als Prozess der Textproduktion (das heißt Sprech- oder Schreibproduktion), soll man von Linearisierung sprechen, aus der sich die Linearität ergibt. Es ist außerdem wichtig, die Fälle klar zu trennen, in denen der Begriff ›linear‹ in Bezug auf zeitliche Aufeinanderfolge gebraucht wird, von denen, wo es um räumliche Ordnung geht.
Relevant wäre in diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung zwischen verschiedenen Erscheinungsformen des Textes – vor allem zwischen seiner mündlichen und schriftlichen Form. Dabei darf auch der Umstand nicht übersehen werden, dass der Textbegriff von einigen Linguisten auf die Gesamtheit der in einer kommunikativen Interaktion auftretenden kommunikativen Signale erweitert wird, so dass Filme, Comics, Bilder mit Sprachmaterial (in Form von Untertiteln, Sprachblasen) und ähnlichem als Texte angesehen werden.[33] Im Rahmen einer solchen Textauffassung erscheint es sinnvoll, nach der Art der benutzten Mittel – wie es zum Beispiel Karel Hausenblas vorschlägt – zwischen lingualen (immer mit paralingualen Elementen), außerlingualen und gemischten Texten (entweder mit der Dominanz von lingualen oder außerlingualen Elementen) zu unterscheiden.[34]
Linearität (im Sinne ›zeitliche Sukzessivität‹) wird als eine zeitlich eindimensionale, in eine Richtung orientierte Struktur des Textes,[35] als die Achse des Nacheinanders beim Produzieren und Rezipieren von Signalen verstanden. Diese Art Linearität hat Vorrang für mündliche Texte, in denen »das instabile, flüchtige Medium der Schallwellen als Träger sukzessiv-linearer Orientierungsleistungen von Sprecher und Hörer« dient, »wobei die Teile der Lautkette in eine Bedeutungsstruktur umgesetzt werden müssen. Die Lautkette besteht auf der untersten Ebene aus Elementen, die ihrerseits keine Bedeutungen tragen. Bedeutungen ergeben sich erst kombinatorisch auf höheren Ebenen«.[36]
Die Linearität hat auch in mündlichen Texten keinen absoluten Charakter. Das zeigt sich unter anderem darin, dass sowohl schriftliche als auch mündliche Texte satzübergreifende Rückbezüge (zum Beispiel durch Pronomina und andere Pro-Elemente, anaphorische Ellipse) enthalten, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, auch abgelaufene Sequenzen im Prozess des Verstehens als ein Ganzes präsent zu halten. Um mit dem Terminus ›Linearität‹ keinen Anschein von einem bloßen Nacheinander zu wecken, gebraucht Roman Jakobson in Bezug auf den sequentiellen Ablauf von (auditiven) Zeichen den Begriff ›Sukzessivität‹.[37]
Als Gegensatz zu Sukzessivität (»Der Vorrang der Sukzessivität in der Sprache wurde manchmal als Linearität missverstanden«) gesprochener Texte und überhaupt komplexer auditiver Zeichen wie zum Beispiel Musik wird nach R. Jakobson die Simultaneität angesehen:
Jedes komplexe visuelle Zeichen, zum Beispiel jedes Gemälde, zeigt eine Simultaneität von verschiedenen Komponenten, während die Zeitfolge die grundlegende Achse der Sprache zu sein scheint [...].[38]
Ein komplexes visuelles Zeichen enthält eine Reihe simultaner Bestandteile, während ein komplexes auditives Zeichen in der Regel aus aufeinander folgenden sukzessiven Teilen besteht.[39] Die Gegenüberstellung der Merkmale ›linear‹ und ›nicht-linear‹ wird dann möglich, wenn es um Texte geht, die für visuelle Rezeption bestimmt sind. Der Ansatz, den wir bei Roman Jakobson finden, lässt uns behaupten, dass das Rezipieren von Comics, Werbetexten mit Bildmaterial und ähnlichen außerlingualen oder gemischten Texten – unabhängig davon, ob diese über Druckmedien oder Hypertext präsentiert werden – als Wechselbeziehung der Achse des Miteinanders (bei Betrachtung jedes einzelnen Bildes) und der Achse des Nacheinanders (beim sukzessiv-linearen Übergang von einem Bild zu dem nachfolgenden beziehungsweise vom Bild zum Text) betrachtet werden kann. Linearität wird in solchen Fällen der Simultaneität gegenübergestellt – ›nicht-linear‹ heißt simultan.
Linearität ist in der Regel eine dominierende Eigenschaft der schriftlichen Texte. Beim Herstellen eines Textes, der mehr als einen einfachen Satz umfasst, entsteht immer die Notwendigkeit, seine Bestandteile geeignet zu organisieren. Der Sprecher oder Schreiber hat die wiederzugebenden Informationen, die sich auf die jeweilige Kommunikationssituation beziehen, in eine Form von einfachen, erweiterten, elliptischen oder zusammengesetzten Sätzen zu kleiden und zugleich diese Sätze (Satzsequenzen) in eine lineare Abfolge zu ordnen. Die Linearität ist dabei das Resultat.
Häufig versteht man unter ›Linearisierung‹ auch Anordnungsprinzipien, nach denen die Abfolge von syntaktischen Elementen im Satz (also ›Wortstellung‹) geregelt wird.[40] Diese Art der Linearität auf der Satzebene wird allerdings bei Besprechung von so genannter ›nicht-linearer‹ Organisation des Hypertextes dem Text im Hypertext nie abgesprochen, denn sonst ginge es nicht um ›herkömmliche‹ Texte, sondern um das, was eher als abweichender oder pathologischer Text klassifiziert wird.
Der Linearisierungsvorgang bei der Produktion eines Textes, der nicht unmittelbar wahrgenommen werden soll, kann nicht-sukzessiv verlaufen, was sich darin zeigt, dass der Autor beispielsweise zuerst den Schluss, dann den Mittel- und zuletzt den Anfangsteil verfassen kann.
Die These, dass die Schrift in unterschiedlichen Portionen und auch nicht-linear rezipiert werden kann,[41] bedarf eigentlich keiner Begründung. Wozu dienen sonst Sachregister und Inhaltsverzeichnisse? Warum gibt man beim Zitieren die Seite an? Und wenn Zitate eingerückt und mit kleinerer Schrift gedruckt werden, bringt es – so Umberto Eco:
[...] den großen Vorteil, daß man Zitate auf den ersten Blick erkennt, daß man sie bei einer kursorischen Lektüre überspringen kann, daß man sich ausschließlich an die Zitate halten kann, wenn sich der Leser mehr für sie als für unsere Auffassung interessiert, und es erlaubt schließlich, die Zitate leicht wiederzufinden, wenn man nachschlagen will.[42]
Nicht-lineares Rezipieren bedeutet in den oben genannten Fällen, dass der Leser an einen linearen Text mit dem eigenen (seinen Intentionen entsprechenden) Linearisierungsverfahren herangeht und – in der Tat – die vom Autor beabsichtigte Linearität verletzt. Das Rezipieren einzelner Textteile erfolgt für den Leser jedoch immer sukzessiv.

Abb. 1: Ein multilinearer Werbe-Text in einer Zeitschrift (DER SPIEGEL 20/2001, S.224-225).
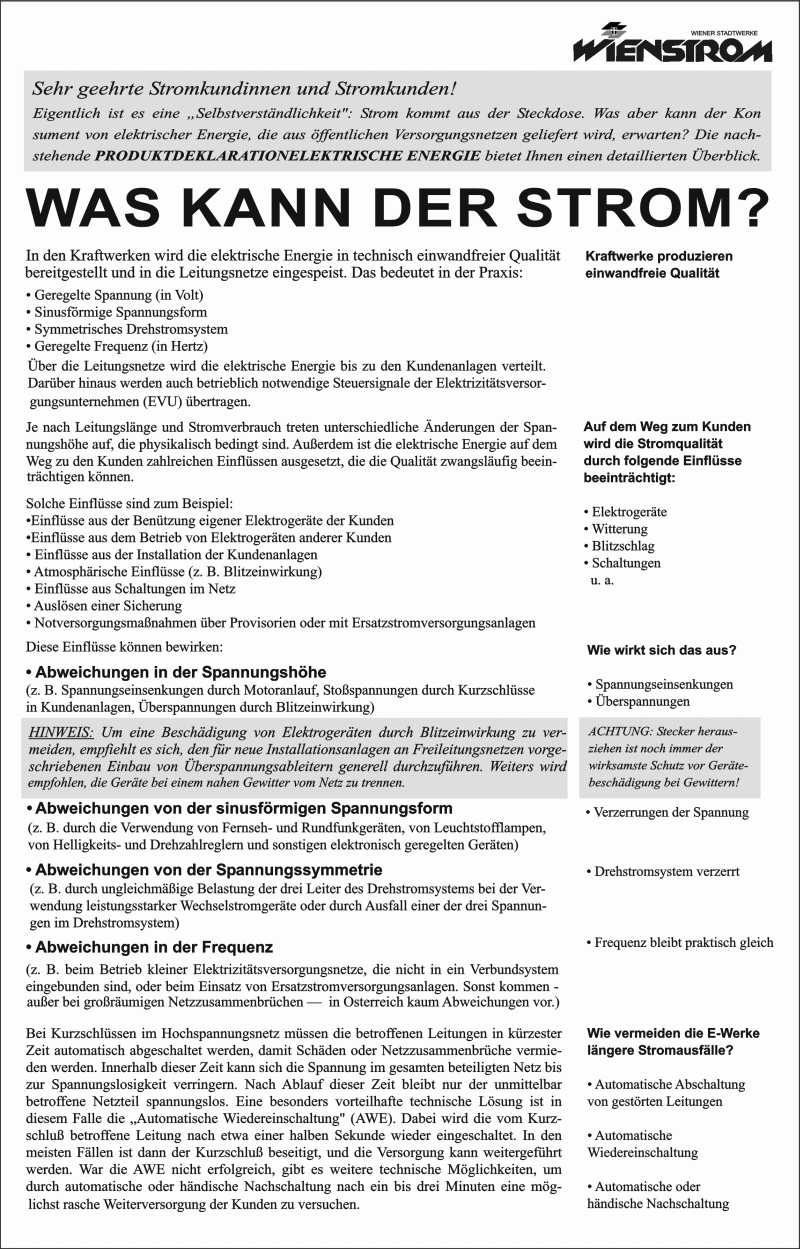
Abb. 2: Ein multilinearer Text eines Info-Flyers der Wiener Stadtwerke (1995).
Es gibt Texte, bei denen die Reihenfolge der Sätze, Absätze oder Texteile beim Lesen wirklich keine Rolle spielt. Diese Art der Textorganisation ist ohne Zweifel textsortenabhängig; sie kommt zum Beispiel in Wahlplakaten[43] und Werbetexten vor, ist aber für viele andere Texte nicht akzeptabel. Jeder in den oberen Abbildungen eins und zwei dargestellte Text weist Köhärenzbeziehungen auf. Man kann bei jedem von ihnen ein einzelne Textteile übergreifendes Thema und eine Intention feststellen, was diese Beispiele als Texte – und nicht als eine Reihe von Kurztexten – charakterisieren lässt. Beide Texte zeichnen sich durch das Merkmal ›nicht-linear‹ aus, das, wie viele Autoren glauben, nur beim Hypertext möglich ist. Diese Besonderheit, die man bei manchen Texten in verschiedenen Medien findet, ist keinesfalls nur für Hypertext spezifisch. Der Terminus ›Multilinearität‹ scheint aber hier besser zu passen, das heißt in den Fällen, wo multiple Leserichtungen möglich sind.
Eine ähnliche – von herkömmlichen schriftlichen Texten abweichende – Organisation der Information halten die Autoren der Internet-Literatur (Hyperfiction) auch für ›nicht-linear‹ und versuchen sie in ihren Werken so zu realisieren. Es geht jedoch auch dabei nur darum, dass der Leser durch Anklicken von Optionen selbst über die Abfolge der Ereignisse in der Erzählung entscheidet. Da die geschlossene Struktur solcher Texte für Textualität zu sorgen hat, sind auch die Lesewege vordefiniert, und der Text ist daher multilinear wie in den hier vorgestellten Werbetexten.
Natürlich gibt uns alles oben Gesagte keine Möglichkeit, vom WWW als von einem Einzeltext zu sprechen, wie es sich T. Nelson anfangs vorstellte. Auch die Mehrzahl von einzelnen Hypertext-Systemen (Sites) im Web weisen weder ein einheitliches Thema noch eine Einzeldokumente übergreifende kommunikative Intention auf, um mindestens nach diesen Merkmalen als Texte eingeordnet zu werden. Meistens ist es auch nicht die Absicht ihrer Autoren, nur einen Text zu schaffen, aber wenn so etwas doch versucht wird, soll die Information so gestaltet werden, dass das Resultat die Kriterien der Textualität erfüllt.
Ein realisierter Hypertext ist also in der Regel kein Einzeltext, sondern eine Datenbank in Form einer Reihe schriftlicher Texte und anderer getrennt abgelegter Informationsmodule (Dateien, Programme), die durch Querverweise Systeme von unterschiedlicher Größe – von einem kleinen Verzeichnis im Dateisystem eines Rechners bis zum World Wide Web – bilden können. Dynamisch betrachtet ist Hypertext dabei ein Rahmenkonzept, das solche Querverweise und die Zusammenwirkung aller Bestandteile umfasst. Statisch lässt sich ein Hypertext-System als eine »Vernetzung von modularisierten Informationseinheiten« am besten beschreiben, »die am Bildschirm dargestellt werden«.[44] Da das Ausgabegerät ›Monitor‹ primär dazu entwickelt wurde, um Daten aus dem Computer als Informationen für den Menschen zu präsentieren (daher auch der Name), ist die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation hier eher ein Nebeneffekt.
Der wohl wichtigste Faktor für die Bedeutung des Mediums ›Computer‹ im Informationsaustausch zwischen Menschen ist heute das Internet mit seinen Möglichkeiten für E-Mail, WAP, Web-TV, IP-Telephony et cetera. Hypertext ist dabei nicht das einzige und nicht immer auch das beste Informationsformat. Die Versuche, Hypertext-Dokumente in der Kommunikation einzusetzen, stoßen stetig nicht nur auf allgemein schon sehr gut bekannte Probleme der Ergonomie der Bildschirmarbeit[45] sondern auch nicht selten auf die Unmöglichkeit der dafür nötigen Vertextung. Das zweite wie auch das erste wird meistens zugunsten des Trends ignoriert, und man findet dann im Internet sowohl informationstechnische und ergonomische, als auch ästhetische und sprachliche Ungetüme.
Da Hypertext es ermöglicht, eine theoretisch unbegrenzte Zahl von Informationsquellen zeitlich und räumlich unbeschränkt zu verbinden (»Human-readable information linked together in an unconstrained way«[46] (unpag.)), werden sowohl Kohärenz als auch die Intentionalität des ganzen Gebildes problematisch. Diese beiden Charakteristiken eines ›normalen‹, kommunikativen Textes stehen im Hypertext unter starkem Druck seines Wachstums. Wenn immer neue Knoten (manchmal sogar von einem anderen Autor als am Anfang) hinzugefügt oder die alten geändert werden, besteht meistens keine Möglichkeit, die Sinnkontinuität (auch wenn eine solche anfangs geplant wurde) zwischen den Teilen zu erhalten. Auch wenn wir in Kauf nehmen, dass ein typisches Hypertext-System allein aus den früher in diesem Artikel besprochenen Gründen kaum für einen Text gehalten werden kann, sollen seine schriftlichen Knoten-Komponenten, um Texte zu sein, die Mindestanforderungen der Textualität erfüllen. Das kann nur dann gewährleistet werden, wenn die Querverweise zwischen den Texten nicht ganz willkürlich angelegt werden, sondern nach einer sorgfältigen Planung, wobei kommunikative Ziele und Besonderheiten der jeweiligen Textsorten berücksichtigt werden. Am besten ist natürlich dazu eine räumlich lineare Verknüpfung von Knoten (wie zum Beispiel in einer so genannten ›Slide Show‹) geeignet, die auch zeitlich linear angezeigt wird. Durch eine solche Topologie wird sich der Hypertext allerdings kaum von einem Buch oder einem Videofilm unterscheiden, was natürlich nicht den Aufwand wert ist. Als eine Alternative ist eine Reihe von Knoten mit Abzweigungen möglich, so dass der Leser nach dem Lesen der zusätzlichen Information im abzweigenden Knoten jedes Mal zum Haupttext wieder zurückkommt. Auf solche Weise sind zum Beispiel viele Präsentationen auf CD-ROM strukturiert.
Wenn man sich eine Hypertext-Anwendung überlegt, soll vor allem ein klarer Unterschied zwischen Kommunikation und Recherche gemacht werden. Der Einsatz von netzartigen Hypertext-Strukturen erscheint kaum in den Situationen möglich, wo eine gezielte Mitteilung oder Aufforderung – Werbung, Instruktion, Anweisung, Bescheid et cetera – vorgesehen ist. Texttheoretisch sind hier nur Einzeltexte ohne Querverweise oder linear organisierte Folgen von mehreren Texten (so genannten ›Wizards‹, ›Slide Shows‹) möglich. Man kann sich also kaum eine Gebrauchsanweisung für eine Arznei vorstellen, die als Hypertext organisiert ist. Nicht einmal der Produzent dieses Medikamentes kann in einem solchen Fall »für Risiken und Nebenwirkungen« haften. Da Anweisungen aufmerksam bis zum Ende gelesen werden sollen, lässt sich ein netzartiger Hypertext auch in der Lernsoftware kaum einsetzen, wo es um klare Instruktionen geht. Man kann also nicht zum Beispiel einen Grammatik-Kurs so aufbauen, dass der Lerner zuerst etwas Unstrukturiertes ›durchnavigiert‹ und abschließend Tests mit Fragen über ganz konkrete grammatische Regeln ablegt.
Ein ganz anderer Fall ist die Recherche. Meistens ist es tatsächlich bequemer, statt viele Seiten durchzublättern und nach einem Sach- oder Inhaltsverzeichnis etwas zu suchen, einfach auf der Stelle den Pfad zur Seite zu nehmen, auf die der Verweis zeigt. Lexika, Wörterbücher, Enzyklopädien, Atlanten und viele andere Nachschlagewerke, auch im Bereich Lernsoftware, sind am besten geeignet, um als netzartige Hypertext-Systeme realisiert zu werden, bei denen der Wert mehr auf Aufbewahrung und Anzeige von strukturierten Daten (= Informationen) gelegt wird. Ein Grammatik-Nachschlagewerk, das so strukturiert ist, wäre also im Unterschied zum Grammatik-Lehrkurs durchaus denkbar.
Eine besondere Kategorie der Textsorten, die man immer wieder versucht, als Hypertext zu präsentieren, sind literarische Texte. Die zahlreichen misslungenen Hypertext-Projekte der Netz-Literatur sprechen dafür, dass sowohl die Technologie als auch das Konzept noch nicht reif für ästhetische Kommunikation sind. Alle Texte der Netz-Autoren (ohne Ausnahme!) werden aus den im vorigen Paragraphen besprochenen Gründen vom Leser kognitiv linearisiert, unabhängig davon, dass man sich bemüht, sie navigationstechnisch multilinear wie in einem Computer-Spiel zu ordnen. Die multilineare Navigation mag künstlerisch originell aussehen, schafft aber meistens Kohärenzschwierigkeiten, so dass viele solche Texte in der Tat gar keine Texte sind. Wenn manche Schreiber versuchen, ihr Werk doch kohärent zu machen, entsteht ein Text, aber kein Hypertext.[47]
Die Technik kann allerdings auch dazu verhelfen, dass manche Probleme, die Hypertext und Text zu konkurrierenden Begriffen machen, gelöst werden. Die Hypertext-Entwicklungsumgebungen sollen neben einer bloßen Syntax-Prüfung der jeweiligen Programmiersprache (Validation) noch eine semantische Analyse von Querverweisen mit Berücksichtigung der Textualitätskriterien zumindest auf Projektierungsetappe bieten. Eine solche Software ist auch denkbar angesichts der schon zahlreichen Programme, die visuelle Planung des Hypertextes ermöglichen. Der Unterschied zwischen ›internen‹ und ›externen‹ Kanten (Internal and External Links)[48] sollte dabei keinen rein deklarativen Charakter haben, sondern zu unterschiedlicher Markierung und Programmierung der Anker führen.
Das Dateiformat der Hypertextdokumente braucht eine Indizierung der einzelnen Wörter (oder Sätze), und das Kommunikationsprotokoll (HTTP) einen Suchmechanismus nach solchen Indizes, so dass Verweise auf einzelne Stellen im Text endlich möglich sind. Aktuell kann man sich, wenn ein Anker angelegt wird, nur auf die Dateien (WWW-Seiten) beziehen. Diese können aber so umfangreich sein, dass man die nötige Stelle nicht gleich findet. Die Suche per Anfrage, die dann mit Hilfe des Browsers erledigt werden soll, macht den Hypertext sinnlos und jeder relationalen Datenbank unterlegen. Die Suche in einer größeren hypertext-basierten Datenbank nur durch Navigation hat sich auch als nicht-produktiv erwiesen, so dass man jetzt immer komplexere Suchprogramme für Hypertextknoten einsetzt (vergleiche dazu Internet-Suchmaschinen), wodurch Hypertext immer öfter einer konventionellen SQL-basierten Datenbank ähnelt. Andererseits werden die meisten großen und komplexen WWW-Sites heute schon fast vollständig aus relationalen beziehungsweise objektrelationalen Datenbanken automatisch generiert, so dass der Hypertext dabei nur als Benutzeroberfläche für die Datenbank auftritt.
Wir haben uns in unserem Artikel absichtlich auf einige der wichtigsten textlinguistischen Arbeiten bezogen, um zu demonstrieren, welche Erkenntnisse man durch die Anwendung von Linguistik in Bezug auf den Hypertext und das Web gewinnen kann. Die hier besprochenen Probleme der Vertextung, sowie die bestehenden Schwierigkeiten der Orientierung in umfangreicheren Hypertext-Systemen machen unbegrenzten Hypertext (wie ihn die Philosophen sehen wollen) zu einer Utopie und verhindern den mehr oder weniger komfortablen Gebrauch von kleineren Hypertext-Systemen.
Die Tendenzen im Hardware-Bereich sprechen heute eher dafür, dass man sich bemüht, den Computer-Bildschirm einem Blatt Papier (nach Lesbarkeit) und den Computer einem Buch (nach Handlichkeit) ähnlich zu machen.[49] Die Jahrtausende der Entwicklung haben das Buch zum immer noch unübertroffenen Medium gemacht, das ergonomisch und kommunikativ am besten an die psychologischen und physiologischen Charakteristiken des Menschen angepasst ist. Es ist daher nur dann möglich, den Hypertext als »Zukunft des Lesens«[50] zu betrachten, wenn er sich in den wesentlichsten Aspekten der Ergonomie, Inhaltsqualität und Ästhetik dem Buch nähert. Die Frage lässt sich also umformulieren: Buch als Zukunft des Hypertextes?
Klaudia Prokopczuk/Arthur Tiutenko (Erlangen)
Dr. Arthur Tiutenko
Sprachenzentrum
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Bismarckstraße 1
D-91054 Erlangen
artyuten@phil.uni-erlangen.de